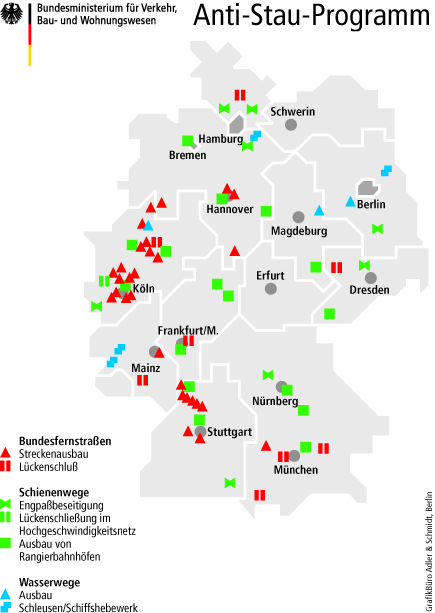Stichwörter, Fragen
& Antworten
In diesen Bundesländern
gibt es Geld
Solarstromanlagen werden von Land zu Land unterschiedlich gefördert. Auszüge aus den
Konditionen
Bayern
Nur für innovative Demonstrationsanlagen gibt es einen Zuschuss bis zu 30 Prozent der
Anlagenkosten (in Ausnahmefällen bis 50 Prozent).
Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, Innovationsberatung,
Prinzregentenstr. 28, 80538 München, Tel. (0 89) 21 62 - 27 87,
www.bmwi.de/homepage/Förderdatenbank/easy.jsp
Berlin
Die "Modernisierungs- und Instandsetzungsrichtlinien" sollen ab Jahresbeginn
in überarbeiteter Form zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Wohneigentumsförderung gibt
es für Bauherren oder Erwerber eines Neubaus eine Erhöhung des zinsverbilligten
Förderdarlehens um bis zu 70 Prozent. Das Umweltentlastungsprogramm (UEP) sieht für
besondere ökologische Investitionen von kleinen und mittelständischen Unternehmen,
öffentlichen Einrichtungen, gemeinnützigen Institutionen oder eingetragenen Vereinen
Zuschüsse je nach Projektgestaltung von 30 bis 90 Prozent vor. Ausgeschlossen von dieser
Förderung sind Privatpersonen.
Investitionsbank Berlin, Bundesallee 210, 10719 Berlin, Tel.
(0 30) 21 25-36 32, www.uep-berlin.de
Brandenburg
Ab Januar 2001 soll eine überarbeitete Richtlinie gelten. Der bisherige Entwurf sieht
vor, dass die zuwendungsfähigen Ausgaben für Solaranlagen unabhängig von ihrer Leistung
bis zu 40 Prozent bezuschusst werden. Das gilt für Gemeinden und Kommunen, da sie nicht
über das 100.000-Dächer-Programm gefördert werden. Die Bemessungsobergrenze liegt bei
15.000 Mark pro kW.
Investitionsbank Brandenburg, Steinstr. 104-106, 14480 Potsdam, Tel. (03 31) 6 60-15 18
Bremen
Keine Förderung. Falls der Förderbetrag für Schulen von 6.000 Mark je Anlage aus dem
Programm "Sonne in der Schule" nicht ausreicht, wird im Einzelfall entschieden.
swb Enordia, Sögestr. 59, 28195 Bremen, Tel. (04 21) 3 59-24 15
Hessen
Es werden nur noch Anlagen von Betreibern gefördert, die beim 100.000-Dächer-Programm
nicht antragsberechtigt sind, also in erster Linie Gemeinden und Kommunen. Sie erhalten ab
1 Kilowatt (kW) bis zu 30 Prozent der Anlagenkosten als Zuschuss, wobei die
förderfähigen Ausgaben auf 15.000 Mark pro kW begrenzt sind. Maximal gibt es 20.000 Mark
für eine Anlage. Das Förderprogramm soll ab Jahresmitte auf eine Festbetragsförderung
von 4.000 Mark pro kW umgestellt werden.
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, Abt. Energie, Mainzer Str. 80, 65189
Wiesbaden, Tel. (06 11) 8 15-15 03
Mecklenburg-Vorpommern
Bis voraussichtlich Ende des Jahres 2001 sollen Zuschüsse an kleine und
mittelständische Unternehmen sowie Freiberufler gezahlt werden. Nicht antragsberechtigt
sind neben den privaten Haushalten beispielsweise Großgewerbe und -handel, Kredit- oder
Versicherungsinstitute, Autohäuser oder Tankstellen.
Wirtschaftsministerium, Ref. Wirtschaft und Umwelt, Joh.-Stelling-Str. 14, 19048 Schwerin,
Telefon (03 85) 5 88-54 32
Niedersachsen
Es werden nur noch Pilot- und Demonstrationsvorhaben innovativer Solartechnologie
natürlicher und juristischer Personen mit einem Zuschuss von bis zu 40 Prozent bedacht.
Während mit anderen Landesprogrammen eine Kumulation nicht möglich ist, kann sie auf
Bundesebene, sofern eine Förderhöchstgrenze von 49 Prozent nicht überschritten wird,
erfolgen. Vor Antragstellung sollte man mit der jeweiligen Bezirksregierung Kontakt
aufnehmen.
Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Friedrichswall 1, 30159 Hannover,
Tel. (05 11) 1 20-56 19, Infotel. (05 11) 1 20-55 00,
www.bezreg-hannover.niedersachsen.de/dez203/home203.html
Nordrhein-Westfalen
Das REN-Programm wurde rückwirkend zum 1. Januar in Kraft gesetzt. Während
Windenergieanlagen und solarthermische Systeme für Brauchwassererwärmung ohne
Heizungsunterstützung jetzt leer ausgehen, wird die Markteinführung der Photovoltaik
weiterhin durch einen Festbetrag unterstützt. Gefördert werden netzgekoppelte
Solarstromanlagen bis zu einer Leistung von 50 kW (in Abstufungen ab 1,5 kW). Das
Landesinstitut nimmt Anträge nur vom 1. Februar bis 30. September entgegen.
Landesinstitut für Bauwesen, Ruhrallee 1-3, 44139 Dortmund, Telefon (02 31) 28 68-0,
Infotelefon (02 31) 28 68-5 95, www.lb.nrw.de/fr-ren.html
Rheinland-Pfalz
Keine Förderung. Für Schulen gibt es noch 50 Prozent der förderfähigen Kosten,
höchstens jedoch 20.000 Mark. Dazu gehören Investitions- und Projektierungskosten.
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Postfach 3269, 55022
Mainz, Tel. (0 61 31) 16-21 15
Saarland
Es ist ein neues Förderprogramm "Zukunftsenergieprogramm plus ZEPP" ab
Anfang des Jahres 2001 geplant, das auch Zuschüsse für Photovoltaik bieten soll.
ARGE Solar, Altenkesseler Str. 17, 66115 Saarbrücken, Tel.
(06 81) 97 62-4 70
Thüringen
Für Photovoltaikanlagen, die im Rahmen des 100.000-Dächer-Programms nicht
förderfähig sind, gibt es 7.000 Mark pro kW. Anlagen, die durch die Bundesförderung
unterstützt werden, erhalten eine zusätzliche Landesförderung von 4.000 Mark pro kW.
Der Höchstbetrag ist mit 100.000 Mark pro Anlage festgelegt. Für Demonstrationsvorhaben
werden 40 Prozent bis zu einer Obergrenze von 300.000 Mark übernommen.
Thüringer Aufbaubank, Europaplatz 5, 99091 Erfurt, Tel. (03 61) 74 47-2 29,
www.th-online.de/wirtschaft/foerdermittel
Stand: Anfang Januar 2001. Auszüge aus dem Solarstrom-Magazin "Photon",
Januar 2001, Solar Verlag, Wilhelmstr. 34, 52070 Aachen, www.photon.de
Quelle: taz Nr. 6357 vom 27.1.2001, Seite 22, 193 Zeilen TAZ-Bericht
, in taz-Bremen-Hamburg: S.34
Seitenanfang
Chronik
für den Handel mit Emissionsrechten
Grundlegend war der Umweltgipfel in Rio – bahnbrechend das Protokoll von Kyoto
Der Handel mit Emissionsrechten für Treibhausgase hat bereits eine lange und
komplizierte Entwicklungsgeschichte. Die wichtigsten historischen Stationen und künftige
Termine:
1992: Auf dem Umweltgipfel der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro wird die
Klimarahmenkonvention zum Schutz des Weltklimas beschlossen. Darin wird das Ziel
formuliert, die Treibhausgas-Konzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu
stabilisieren, das eine gefährliche, vom Menschen verursachte Störung des Klimasystems
verhindert.
1995/1996: Auf Vertragsstaaten-Konferenzen in Berlin und Genf wird verhandelt,
in welcher Form die Klimarahmenkonvention umgesetzt werden kann. Im Vordergrund stehen
allerdings noch Fragen zur Verfahrensweise.
1997: Auf der 3. Vertragsstaaten-Konferenz in Kyoto werden verbindliche
Reduktionsverplichtungen für Industrieländer festgelegt. In der Periode von 2008 bis
2012 sollen insgesamt 5,2 % der Treibhausgase gegenüber dem Emissionsniveau von 1990
reduziert werden. Außerdem werden im Protokoll von Kyoto flexible Mechanismen
aufgeführt, darunter das Emissions Trading, Projekte durch gemeinsame Umsetzung von
Minderungsmaßnahmen (Joint Implementation und Clean Development Mechanism). In der
Europäischen Union soll durch eine differenzierte Lastenverteilung (so genannte
EU-Glocke) eine Reduktion von 8 % erreicht werden.
1998/1999: Auf den weiteren Klima-Konferenzen in Buenos Aires und Bonn werden
über die Ausgestaltung des Handels mit Emissionsrechten keine Einigungen erzielt. Die
Konferenzen werden von Umweltschützern als Enttäuschung gewertet.
18. Mai bis. 6. Juli 1999: Die Dachverbände der europäischen
Elektrizitätswirtschaft Unipede und Eurelectric führen gemeinsam mit der Pariser Börse
einen computergestützten Handel mit Kohlendioxid-Emissionsrechten durch. 16 virtuelle
Stromerzeugunger aus 15 Staaten simulieren mehrere Handelsjahre. Ähnliche
Simulationsrunden finden weiterhin statt und wurden bspw. auf der 5. Klima-Konferenz in
Bonn präsentiert. An dem Testhandel nimmt auch die deutsche Hamburgische
Electricitäts-Werke AG (HEW AG) teil.
Januar 2000: Die Erdöl-Konzerne BP Amoco und Shell praktizieren einen
konzerninternen Handel mit Kohlendioxid-Emissionsrechten. Gehandelt wird u.a. zwischen
Ölförderungs-Stellen und Tankstellen.
Januar 2000: Ein Projekt der Weltbank wird in großem finanziellen Umfang
eingerichtet: Der "Prototype Carbon Fund" (PCF). Das Pilotprojekt, an dem u.a.
die europäischen Unternehmen BP Amoco, Deutsche Bank, Electrabel/Suez-Lyonnaise des Eaus,
Gaz de France und RWE beteiligt sind, bietet interessierten Unternehmen und Ländern
Beteiligungen in der Größenordnung von je 5 bzw. 10 Mill. US-$ an. Mit dem Geld sollen
Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern finanziert werden. Als Gegenleistung sollen
die Investoren Emissionsgutschriften erhalten.
8. März 2000: Die EU-Umwelt-Kommissarin Margot Wallström legt ein
"Grünbuch" zum Handel mit Treibhausgas-Emissionen vor. Rund 45 % der
Industrie-Emissionen von Kohlendioxid sollen ab 2005 an Schadstoff-Börsen gehandelt
werden. In den Handel sollen Unternehmen aus den Branchen Strom- und Wärme-Erzeugung,
Eisen und Stahl, Raffinerien, Chemische Industrie, Glas, Keramik und Baustoffe, Papier und
Druck einbezogen werden.
Juni 2000: In einem Pilotprojekt verkauft die HEW AG 24 000 Tonnen Kohlendioxid
an das kanadische Energieversorgungsunternehmen TransAlta in Calgary. Mit dem Erlös
werden Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Hamburg finanziert.
4. August 2000: Erstes informelles Treffen von Experten aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik in Berlin zu einem Interessen übergreifenden Austausch zum Thema
Emissionsrechtehandel in Deutschland.
Anfang Oktober 2000: Zweites Treffen der Expertenrunde unter dem Titel:
"Emissions Trading Experts Group." Es sollen erste Erfahrungen der
Arbeitsgruppen ausgetauscht werden.
13.-14.November 2000: Die Hoffnungen von Klimaschützern richten sich auf die
anberaumte 6. Vertragsstaaten-Konferenz vom 13.-24. November in Den Haag. Experten
erwarten Überraschungen insbesondere bei der Festlegung von Kriterien für die Anrechnung
von Projekten, die in zwischenstaatlichem Rahmen zur Erzielung von Emissionsminderungen
durchgeführt werden.
Anfang 2001: Zur Vorbereitung auf einen Handel mit Kohlendioxid-Emissionsrechten
soll in Großbritannien an der Londoner Börse in Zusammenarbeit mit der International
Petroleum Exchange (IPE), einem Umschlagplatz für Öl und Erdgas, mit einem Handelssystem
für Kohlendioxid-Emissionsrechte experimentiert werden. Das Lizenzmodell wurde der
EU-Kommission bereits präsentiert.
2002: Es wird das In-Kraft-Treten des Kyoto-Protokolls erwartet durch die
Ratifizierung der an der Klimarahmenkonvention beteiligten Länder.
2005: Voraussichtlicher Beginn des Handels mit Emissionsrechten für
Kohlendioxid in der Europäischen Union.
2008: Beginn der ersten Periode für den Emissionshandel weltweit. Bis 2008
müssen die Länder der EU ihre Kohlendioxid-Emissionen um 8 % reduzieren, Deutschland
sogar um 25 %.
Quelle: Handelsblatt 16.8.2000
Seitenanfang
Korruption,
empirisch (Als Analogie zum rheinischen Braunkohleklüngel )
Bei Korruption handelt es sich - genauer betrachtet - um
Vernetzungstechniken, die auf Entscheidungen Einfluss nehmen, auf die nach der jeweiligen
Systemlogik von Politik, Wirtschaft und Bürokratie von außen gar kein Einfluss genommen
werden kann
Korruption, so urteilt die Soziologie nahezu einhellig, ist
das Hereinragen der Bindungsinstrumente der alten Welt in die neue Welt. Für die von uns
für normal gehaltene und sogar in Verfassungsrang gehobene Entkoppelung von Politik und
Wirtschaft bezahlen wir mit - je nach der Mächtigkeit der alten Welt - mehr oder weniger
zahlreichen Fällen der Korruption. Wäre gar keine Korruption mehr festzustellen, hätte
sich unsere neue Welt endgültig historisch losgekoppelt von der alten Welt, in der sie
entstanden ist. Wie wünschenswert das ist, ist mehr als unsicher, da diese alte Welt
über Mechanismen der lokalen Herstellung und Sicherung von Vertrauen und Verlässlichkeit
verfügte, von denen wir nicht wissen, ob die neue Welt Ersatz für sie schaffen kann. Was
wir Korruption nennen, ist nichts anderes als ein solcher Mechanismus der Schaffung von
Verlässlichkeit und Vertrauen. Ironischerweise handelt es sich sogar um einen
Mechanismus, der in der modernen Welt noch bindungsstärker ist als in der alten. Denn Korruption kriminalisiert, macht erpressbar und
schafft damit die Basis für ein Vertrauen, das zwar auf Heimlichkeit angewiesen ist, aber
genau daraus ein wie immer zeitlich begrenztes Selbstvertrauen schöpfen kann. Schaut man
sich genauer an, was jeweils vorliegt, wenn etwas passiert, was wir Korruption nennen,
sieht man relativ leicht, dass es sich um Vernetzungstechniken zwischen verschiedenen
Systemen - meist, aber nicht nur zwischen Politik und Wirtschaft - und zwischen
verschiedenen Organisationen - meist, aber nicht nur zwischen Parteien, Behörden und
Unternehmen - handelt. Diese Vernetzungstechniken nehmen auf Entscheidungen Einfluss, auf
die nach der jeweiligen Systemlogik von außen gar kein Einfluss genommen werden kann.Denn
wir sind es ja gewohnt, politische Entscheidungen nur politisch zu begründen und
wirtschaftliche Entscheidungen nur wirtschaftlich. Korruptionsfälle jedoch sind Fälle, in denen politische
Entscheidungen wirtschaftlich oder auch, das wird seltener gesehen, dann aber sogar für
wünschenswert gehalten, wirtschaftliche Entscheidungen politisch begründet werden.
Korruption ist der Fall, wenn Systeme sich durch andere Bedingungen als die eigenen
konditionieren lassen. Ein Problem ist das deswegen, weil damit die systemeigenen
Konditionen der Systeme abgehängt werden. Eine korrupte Politik ist eine Politik, die
sich demokratisch nicht mehr beeinflussen lässt.Eine korrupte Wirtschaft ist eine
Wirtschaft, in der der Markt nicht mehr das letzte Wort hat. Korruption bricht, mit
anderen Worten, die Geschlossenheit der Systeme auf und passt sie an das an, was in ihrer
Umwelt für sinnvoll gehalten wird. Der entscheidende Punkt ist nun, dass das Motiv für
diese Öffnung nicht in den Funktionssystemen selber liegt, sondern in Organisationen, die
sich in diesen Systemen zu behaupten suchen. Nicht die Wirtschaft
oder die Politik werden korrumpiert, sondern Unternehmen, Parteien und Behörden. Diese
Organisationen sind systematisch in der Lage, ihre eigenen Überlebensbedingungen
unabhängig von dem einzuschätzen, was das freie Spiel der Wirtschaft oder der Politik
ihnen andernfalls in Aussicht stellen würde. Sie beziehen sich, könnte man auch
sagen, auf die Gesellschaft insgesamt und nicht nur auf eine partielle Systemlogik.
Allerdings tun sie das aus ihrem jeweils ebenfalls partiellen Blickwinkel heraus. Trotzdem
sind wir aber selbst in diese Gesellschaft verstrickt, deren Korrumpierbarkeit wir
befürchten. Was wir Korruption nennen, ist der Einbruch des Realitätsprinzips in
geschlossene Systeme. Wer die Korruption verurteilt, kann sich auf allgemeine, also in
jedem Einzelfall unrealistische Prinzipien berufen. Daher wissen diejenigen, die sich
korrumpieren lassen, immer die besseren Gründe auf ihrer Seite. Aber sie können diese
besseren Gründe nicht kommunizieren, weil es sich um hochgradig lokale und individuelle,
eben empirisch begründete Gründe handelt, von denen wir gewohnt sind, sie auf bloßes
Eigeninteresse zurückzurechnen und deswegen für verdächtig zu halten, obwohl doch auf
einer wiederum prinzipiellen Ebene das Eigeninteresse in unserer Gesellschaft das letzte
Wort hat.Die alte Welt schuf Vertrauen und Verlässlichkeit über Vernetzung, Patronage
und Klientelbildung. Die neue Welt setzt dagegen auf die Ausdifferenzierung der
Funktionssysteme und die möglichst unbeschränkte, nur von den ebenfalls
ausdifferenzierten Massenmedien beargwöhnte Realisierung der jeweiligen
Systemeigenlogiken. Unsere Organisationen jedoch stehen nach wie vor mit einem Bein in der
alten Welt und mit dem anderen in der neuen. Unternehmen, Parteien und Behörden erden,
wenn man so will, die abstrakten Systemlogiken. Und sie berufen sich dazu auf Mitarbeiter,
die im Gegensatz zu dem, was die Systemlogiken leisten, Augen im Kopf haben und zu sehen
glauben können, was sich um sie herum abspielt. Was wir Korruption nennen, ist, so
gesehen, nichts anderes als die Durchsetzung individueller Rücksichten in einer
Gesellschaft, die sich deswegen "liberal" nennt, weil sie ihren Individuen nicht
über den Weg traut und daher Mechanismen entwickelt, die möglichen Fehler dieser
Individuen möglichst schnell korrigieren zu können - unter Verweis auf die Gesetze des
Marktes oder die Weisheit der Demokratie. Niklas Luhmann hat einmal vorgeschlagen, die
moderne Gesellschaft nur dann "rational" zu nennen, wenn sie es schafft, die aus
den Systemlogiken ausgeschlossenen Individuen in den Systemen wieder vorkommen zu lassen. Wenn Korruption darauf hinausläuft, Partialinteressen gegen allgemeine
Interessen zu ihrem Recht zu verhelfen, müssen wir das bis auf Weiteres um so eher für
rational halten, als diese allgemeinen Interessen schon längst nicht mehr zweifelsfrei
behauptet werden können. Unsere spontane moralische Empörung über Fälle der
Korruption ist ganz offensichtlich ein Streit der Gesellschaft mit sich selbst.
Quelle: TAZ 23.1.2000
Seitenanfang
Helmut
Kohls Großvater Schwarze Kassen, Selbstbedienung, Insidergeschäfte -
neue Nachrichten zu Konrad Adenauer (Teil 1).
Nachdem der ehemalige CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Helmut Kohl in der
Öffentlichkeit nicht mehr als
Teil der »CDU-Leitkultur« vorgezeigt werden kann, hat eine Suche nach neuen bzw.
alten Vorbildern eingesetzt. Am 5. Januar 2001 jährte sich der 125. Geburtstag von Konrad
Adenauer, Gründungsvater der CDU und erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Dies dient der CDU und der Konrad-Adenauer-Stiftung als Anlaß, um während des ganzen
Jahres eine Serie von Ausstellungen, Vorträgen, Veröffentlichungen durchzuführen,
zahlreiche davon im Ausland (Bosnien-Herzegowina, Polen, England, Ukraine, USA,
Indonesien, Palästina usw.). Der Rat der Stadt Köln gedachte des ehemaligen
Oberbürgermeisters (1917- 1933) in einer Sondersitzung, der Kölner Erzbischof Josef
Kardinal Meisner feierte ein Pontifikalamt, die seit Herbst 2000 CDU-geführte
Stadtverwaltung läßt einen »Konrad- Adenauer-Wanderpfad« gestalten, an dem die
kommunalpolitischen Verdienste Adenauers bewundert werden sollen. Gleichzeitig wurden
erstmalig Fakten aus Adenauers Kölner Tätigkeit bekannt, die ein neues Licht auf diese
Mythenbelebung werfen. 1)
Schwarze Kasse im Rathaus
Am 18. 9. 1917 wurde der langjährige erste Beigeordnete Konrad Adenauer zum Kölner
Oberbürgermeister gewählt. Zur Beruhigung des Publikums stimmte er einem Beschluß der
Stadtverordnetenversammlung vom selben Tag zu. Danach war der OB verpflichtet, alle
Tantiemen an die Stadtkasse abzuliefern, wenn er »als Vertreter der Stadt zum Mitglied
des Aufsichtsrates oder Vorstandes einer Erwerbsgesellschaft bestellt werden sollte.« Der
tiefkatholische Zentrumspolitiker ließ zwei Monate später den Beschluß abändern, was
umso leichter fiel, da aufgrund des preußischen Dreiklassenwahlrechts im Stadtrat noch
keine Sozialdemokraten oder andere lästige Vertreter sozialer Interessen saßen. Am 23.
11. 1917 wurde das Gegenteil beschlossen: »... steht die hieraus aufkommende Vergütung
zur freien Verfügung des Oberbürgermeisters.« Es wurde zwar nebulös festgelegt, das
Geld solle »zum Wohle der städtischen Beamten« verwendet werden, aber für alle Fälle
hieß es: »Eine Rechnungslegung findet nicht statt.«
Auf dieser Grundlage glitt der neue OB skrupellos vom Legalen zum Illegalen. Er ließ
das Konto »Dispositionsfonds« einrichten. Darauf lenkte er die erheblichen Summen, die
ihm von seinen Aufsichtsratsmandaten zuflossen. 14 000 Mark jährlich kamen von der
Provinzial Feuerversicherung. Das
schon damals mächtige Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk (RWE) überwies Adenauer
jährlich ebenfalls etwa 14 000 Mark, manchmal auch 19 000. Die schwarze Kasse wurde von Geschäftspartnern auch direkt
aufgefüllt. So spendete Direktor Dr. Brüning von der Kölner Filiale der Deutschen Bank
30 000 Mark in den Fonds, versehen mit dem unnötigen Zusatz »zur freien Verwendung.«
Immer wieder ließ Adenauer sich zwar Beträge zwischen 50 und 150 Mark aus dem Fonds
auszahlen, die er dann persönlich an mehr oder weniger notleidende Beamte überbrachte.
Kleine Beamte bekamen kleine Beträge, höhere Beamte bekamen höhere Beträge. So wurde
Bürodirektor a. D. Ernst für eine Kur im schönen St. Moritz mit 800 Mark unterstützt.
Das »Wohl der Beamten« konnte man vielleicht auch noch entdecken, wenn 75 Mark an die
Polizisten Ley und Schiefer gingen, hatten sie doch während des sechswöchigen Urlaubs
der Familie Adenauer im Grandhotel von Chandolin im schweizerischen Wallis 57 Nachtwachen
geschoben. Aber auch Strafzettel wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung, zu der
der OB seinen Chauffeur häufig antrieb - durch Remagen etwa donnerte er einmal mit 60
km/h, 30 waren erlaubt -, wurden aus dem Fonds beglichen.
Die meisten Beträge flossen jedoch in andere Richtungen. Rote Rosen für 100 Mark und
eine venezianische Vase für 575 Mark für seinen Freund, Geheimrat Louis Hagen vom
Bankhaus Sal. Oppenheim, wurden dem Dispositionsfonds ebenso entnommen wie 300 Mark an die
Nähstube des Vaterländischen Frauenvereins, dem die Gräfin Schnitzler vom befreundeten
Bankhaus J. H. Stein vorstand. Als Geschenk an den Papst wurde der Prachtband »Der
goldene Schrein« für 50 Mark in weißes Leder gebunden. Das Frühstück des
Stiftungsrates der Johannes-Fastenrath-Stiftung im Kölner Restaurant »Bastei« ließ
Adenauer ebenso aus seinem Fonds bezahlen wie den Lunch mit dem Wallstreet-Banker
McKittrick im Berliner Hotel Adlon.
Förderung von Militaristen
Der Empfängerkreis war zwischen christlichem Traditionsmilieu, Technikfetischismus und
Karneval breit gefächert. Katholischer Frauenbund, Sankt-Elisabeth- Krankenhaus,
Reichsbund der Kinderreichen und Männergesangverein Concordia wurden ebenso bedacht wie
der Düsseldorfer Areo-Club, der Deutsche Motorradfahrerverband (»Ehrenpreis
Nürburgring«) und der ADAC. Die Spitzen des einheimischen Brauchtums durften nicht
fehlen; so wurden der Karnevalsgesellschaft Rote Funken erst 25 Flaschen, dann 50 Flaschen
des edlen Tropfens »Zeltinger Kirchenpfad« angeliefert.
Besonderes Gewicht legte der Zentrumspolitiker auf die Förderung von militaristischen
Vereinigungen und großdeutschen Bestrebungen. Dabei wird nebenbei die Legende widerlegt,
Adenauer sei ein »rheinischer Separatist« gewesen. Vor allem war er, spätestens seit
Mitte der 20er Jahre, ein Großdeutscher. Er stiftete zwar schon mal die Ehrenpreise für
das »Rheinlandbefreiungsschießen« 1930 und half der Mainzer Rudergesellschaft beim Kauf
eines »Befreiungsachters«. Als Vizepräsident der Deutschen Kolonialgesellschaft
(»Unerbittlich fordern wir Deutschlands Recht auf eigene Kolonien«), bestritt er aus der
schwarzen Kasse 25 Exemplare »Deutscher Kolonialkalender« für die Volksbüchereien der
Stadt. Er nervte den Schuldezernenten Linnartz so lange, bis dieser dem Geschenk von
nochmals 50 Exemplaren des Kalenders zustimmte und sie in den Schulen verteilte. Der
Kölner Kreiskriegerverband und der Preußische Landeskriegerverband durften für das
Kriegerdenkmal im Hindenburgpark ebenso auf eine Gabe hoffen wie das Kürassierregiment 8,
das immerhin 2 000 Mark bekam.
Für die Kundgebung »Danzig bleibt deutsch« des Vereins für das Deutschtum im
Ausland floß aus dem Dispositionsfonds eine Spende wie für das Wohltätigkeitskonzert
zur »Unterstützung notleidender Kolonialdeutscher in Ost- und Westafrika«. Adenauer
subventionierte Auslandsvereine wie den Deutschen Schulverein Antwerpen und die
Landsmannschaft Eupen- Malmedy-Monschau. Rittmeister a.D. Habermann bekam eine Spende für
das »Deutsche Haus« in Olmütz. Aus dem Fonds bezahlte Adenauer ab 1931 auch das
Abonnement der »Deutschen Führerbriefe«, die von seinem Freund Paul Silverberg
herausgegeben wurden, Chef der Rheinbraun AG, die für die Beteiligung Hitlers an der
Reichsregierung warben.
Als früher Bewunderer Benito Mussolinis förderte er sogleich nach dem Sieg des
Faschismus in Italien die Errichtung des Italienischen Kulturinstituts in Köln und
bedachte es mit einer Spende aus seiner schwarzen Kasse.
Den Kreuzer »Cöln« hatte Adenauer besonders ins Herz seines Dispositionsfonds
geschlossen. Dem Marineverein Köln spendierte er die Fahrkarten zur Taufe des Kreuzers im
Mai 1928 in Wilhelmshaven. Der Mannschaft ließ er immer wieder nicht nur Zigarren,
Zigaretten, Wein, Bücher und Schallplatten (mit Extrarationen zu Weihnachten) sowie der
Schiffskapelle kostbare Noten zukommen, sondern beglückte sie auch mit Freiabonnements
des Kölner Stadt-Anzeigers und der besonders nazifreundlichen »Kölner Illustrierten
Zeitung« aus dem Hause DuMont Schauberg. Dem Kommandanten bezahlte er die Rahmung eines
Bildes, und für die Gattin legte er ein »Kristall-Flakon« bei. Eine Extra-Lieferung
Zigarren der Marke »Adenauer« ging an den Matrosen, »welcher den Herrn OB auf dem
Kreuzer Cöln bedient hat«.
Hatte schon all das nichts mit dem »Wohl der städtischen Beamten« zu tun, so
notierte bei so mancher Barentnahme aus dem Dispositionsfonds der Bürodirektor des
OB-Vorzimmers: »1 300 Reichsmark abgehoben und dem Herrn OB ausgehändigt. Zweck ist mir
unbekannt«. Die nicht ausgegebenen Summen standen dem OB ganz »zur freien Verfügung«.
Die Tantiemen der restlichen, im Lauf der 20er Jahre hinzukommenden insgesamt zwölf
Aufsichts- und Verwaltungsratsmandate zahlte er meist überhaupt nicht mehr in den Fonds
ein, so die Tantiemen der Rheinbraun AG, der Deutschen Lufthansa, der Rhein-Main-Donau AG
und der Ruhrgas AG.
»Freies Wohnen« und sonstige Nebeneinnahmen
Eine ähnliche Schwankungsbreite zwischen legal und illegal herrschte bei seinem
Gehalt. Es war das höchste aller Politiker im deutschen Reich. Das kam vor allem durch
die sichtbaren und unsichtbaren Nebenleistungen. Durch Aktienspekulation, Einheirat in die
Familie des vorherigen OB Wallraf und durch langjähriges Beigeordnetengehalt war er so
vermögend, daß er sich bereits lange vor Amtsantritt als OB in der Max-Bruch- Strasse 6
- in bester Lage, Prominentenviertel Lindenthal, direkt am Stadtwald - eine dreistöckige
14-Zimmer-Villa hatte bauen lassen. Trotzdem bestand er auf »freier Wohnung«. Er ließ
sich zunächst unter anderem 20 000 Mark jährlich für »Licht und Brand« bewilligen,
womit - so die wenigen Spötter, die davon überhaupt erfuhren - nach damaligen Preisen
ganz Lindenthal hätte beleuchtet und beheizt werden können.
Schließlich erhielt der kaltschnäuzige Gehaltsjäger zu seinem Grundgehalt von 36 000
Mark jährlich 5 250 Mark Orts- und Kinderzuschläge, 10 000 Mark Aufwandsentschädigung
und noch sage und schreibe 43 000 Mark »Wohngeld«. Dabei wurden die
Aufwandsentschädigung ebenso wie die Hälfte des Wohngelds auf seine Pension angerechnet,
stellten also ein verdecktes Gehalt dar, was durch den Stadtverordnetenbeschluß über
»freies Wohnen« natürlich nicht gedeckt war. Für 43 000 Mark übrigens konnte man sich
damals ein Haus mit sechs Zimmern und Grundstück kaufen, so daß sich der Kölner OB
jährlich aus dem städtischen Haushalt den Gegenwert eines ordentlichen Eigenheims
schenkte, und zwar 15mal, denn die Regelung galt bis 1933.
Darüber regten sich vor allem die sozialdemokratischen und christlichen Zeitungen auf.
Dabei kannte das Publikum damals die Feinheiten noch gar nicht, mit denen der raffgierige
Politchrist das »freie Wohnen« auf die Spitze trieb. Neben dem üppigen »Wohngeld«
ließ er sich die Rechnungen für Gas, Wasser und Strom aus der Stadtkasse noch extra
ersetzen, wofür die Stadtwerke eigens Rechnungsduplikate an das OB- Zimmer zu schicken
hatten. Überflüssig zu betonen, daß auch die Hausreparaturen - bis zu 15 000 Mark im
Jahr - aus der Stadtkasse bezahlt wurden.
Privatgeschäfte im Rathaus
Auch sämtliche Versicherungen - Feuer/Gebäude, Haftpflicht, Diebstahl - wurden aus
der Stadtkasse ersetzt. Dasselbe galt für die Grundsteuern und Hypothekenzinsen. Dasselbe
galt schließlich auch für zahlreiche Kleinigkeiten wie die Urlaubs-
Reisegepäckversicherung (»zu übernehmen auf Haushaltsplan Zentralverwaltung, Position
42, Sonstiges«), wobei der OB in der Police festhalten ließ, daß die Versicherung auch
für alle Familienangehörige gelte, selbst »wenn diese nicht in Begleitung des
Versicherungsnehmers reisen.« Als der NSDAP-Nachfolger im OB-Amt, Dr. Riesen, im April
1933 die Reisegepäckversicherung kündigte, stellte der Provinzial- Versicherungsagent
Heups, der die Versicherung mit Adenauer abgeschlossen hatte, erstaunt fest, »daß die
Prämie offenbar der Stadt Köln zur Last fällt«, wovon er keine Kenntnis gehabt habe.
Wenn in der Max-Bruch-Straße »Kanalgerüche im Herrschaftsbadezimmer« das
christliche Riechorgan störten oder wenn die Gaskesselanlage ruckelte, ließ der OB die
Ingenieure der Stadtwerke antanzen. Sie erstellten in ihrer Dienstzeit kostenlose
Gutachten und überwachten die Reparaturarbeiten. Dasselbe galt bei der Begutachtung der
Angebote für den Swimmingpool nebst Umkleidehaus, für das Kühlsystem des Weinkellers
und für den Bau der Tennisanlage im Garten. Das fiel auch deshalb nicht auf, weil
gleichzeitig die städtischen Gärtner in Adenauers großem Garten auf Steuerzahlers
Kosten das Unkraut jäteten und die Rosen pflegten.
Auch im Rathaus ließ Adenauer durch die städtischen Beamten zahlreiche seiner
persönlichen Angelegenheiten abwickeln, obwohl er zu Hause vier Angestellte
beschäftigte. Bürodirektor Wolfgarten bestellte für Adenauers Privatbedarf Haigs Gold
Label Scotch Whisky, Kölnisches Wasser für den Urlaub, Gartenschaukeln für die Kinder.
Die Beamten sichteten die einlaufenden Prospekte, wenn Frau Adenauer vor der Auswahl des
hübschesten Modells für Doppelwaschtische in den Badezimmern stand (»Ia
Caracalla-Marmor oder Hartsteingut?«). Auch die Bestellung von »drei Tuben der schon
früher verschiedentlich bestellten Nasensalbe« beim Apotheker Burgener im walisischen
Chandolin oblag dem OB-Büro. Wenn etwa die Extra- Spezialguß-Bratpfanne aus der Schweiz
im Rathaus eintraf, meldete der Bürodirektor pflichtgemäß per amtlichem Vermerk an die
OB-Gattin: »Das Bronzegefäß ist eingetroffen.«
1) Die Fakten finden sich im Historischen Archiv der Stadt Köln, Bestand Adenauer, und
Bundesrarchiv Berlin, Bestand Deutsche Bank. Eine erste Veröffentlichung erfolgte in der
Ausgabe Köln der taz vom 4. 1. 2001. Für Teilaspekte der hier vertieften Fragestellung
sind zu empfehlen: Henning Köhler, Adenauer. Eine politische Biographie. Berlin
(Propyläen) 1994; Eberhard Czichon, Die Bank und die Macht. Hermann Josef Abs, die
Deutsche Bank und die Politik. Köln (Papyrossa) 1995.
(Morgen Teil 2: Das Rathaus als Zockerbüro)
Quelle: Junge Welt Politik 17.1.2001
Seitenanfang
Rathaus als Zockerbüro
Schwarze Kassen, Selbstbedienung, Insidergeschäfte - neue Nachrichten zu Konrad Adenauer
(Teil 2 und Schluß).
In den Jahren 1919 und 1925 kaufte Adenauer zu den 1 864 Quadratmetern seines
Grundstücks weitere 3 051 Quadratmeter an der Kitschburger und der Max-Bruch-Straße von
der Stadt hinzu, um ein zweites Haus und einen
Tennisplatz bauen zu lassen. 1932 mahnte das städtische Liegenschaftsamt untertänigst
an, daß der Restkaufpreis von 23 740 Mark - ein unter dem Marktpreis liegender
Freundschaftspreis, den sich Adenauer als Vertreter des Verkäufers selbst genehmigt hatte
- immer noch nicht beglichen sei. Adenauer wollte nicht zahlen, ging aber auf das Angebot
ein, auf diese Schuld sechs Prozent Zinsen und 1,5 Prozent Stundungszinsen zu zahlen. Die
zahlte er zwar tatsächlich an die Stadthauptkasse, interpretierte aber das »freie
Wohnen« so, daß er sich die 7,5 Prozent Zinsen umgehend aus eben derselben
Stadthauptkasse zurückerstatten ließ.
Schließlich kannte das Publikum auch weitere Nebeneinkünfte des nimmersatten
Selbstbedieners nicht . So rechnete er
etwa für eine Sitzung des Aufsichtsrates der RWE 90 Mark Tagegeld ab. Für einen Arbeits- und Sitzungstag des Preußischen Staatsrates
rechnete er 150 Mark Tagegeld ab; damit kam er beispielsweise allein im Zeitraum vom 6. 5.
bis 3. 7. 1921 auf 2 400 Mark, was dem Jahresgehalt eines kleinen Beamten entsprach.
Pfandbriefe, Konten und Aktiendepots
Zeitweise glich sein Rathaus-Vorzimmer einem Zockerbüro. »Wir machen höflichst
darauf aufmerksam, daß unsere Bestände in achtprozentigen Goldpfandbriefen zur Neige
gehen und bitten Sie, im Bedarfsfalle möglichst umgehend bei uns oder unseren
Niederlassungen Offerten einzuholen«, so hieß es etwa in einem Angebot der Deutschen
Bank, das im Rathaus umgehend bearbeitet werden mußte. Adenauer unterhielt für seine
umfangreichen Deals nicht nur zwei Girokonten bei der Städtischen Sparkasse Köln,
sondern Konten und Aktiendepots bei mehreren Banken: C.G. Trinkaus (Düsseldorf), Sal.
Oppenheim (Köln), Deutsche Bank (Köln) und Comes&Co (Berlin).
Die privaten Aktiendeals ihres OB waren für die städtischen Beamten so normal, daß
sie ihm schon mal ein paar Millionen aus der Stadtkasse vorstreckten. So traf am 27. 1.
1923 mit vertraulichem Schreiben im Rathaus das Angebot der Deutschen Bank über den Bezug
junger Aktien der Rheinbraun AG ein, bei der Adenauer im Aufsichtsrat saß. Die 40 000
Aktien kosteten 613 000 Mark, die Entscheidung mußte am selben Tag getroffen werden. Der
Bürodirektor fertigte eine Zahlungsanweisung an die Stadtkasse (»außerordentliche
Bedürfnisse«), zwei Tage später meldete die Kämmerei der am höchsten verschuldeten
deutschen Stadt Vollzug. Bemerkenswert hierbei ist auch, daß die Verwaltungsspitze der
Stadt diesen Rechtsbruch ausnahmslos mittrug - eine Überweisung dieser Größenordnung
und Dringlichkeit mußte von mehreren Spitzenbeamten abgesegnet werden. Erst drei Monate
später ordnete Adenauer an: »Der von der Stadthauptkasse verauslagte Betrag von 613 000
M wird dieser aus meinem Girokonto 8080 bei der Städtischen Sparkasse erstattet.«
Natürlich ohne Zinsen. Solche Beträge - heute wären das gut fünf Millionen DM - waren
auf Adenauers Girokonto ohne Schwierigkeit verfügbar.
Gleichzeitig wußte der christliche Politiker auf den damaligen Katholikentagen
geläufig gegen »Materialismus und Mammonismus im deutschen Volke« zu wettern und den
»Schwund des Religiösen« zu beklagen, als hätte er bei seinem heutigen Fan Josef
Kardinal Meisner die Weihnachstpredigt gehört.
Den Höhepunkt erreichte der vermutlich ranghöchste deutsche Aktienspekulant - er war
nach Reichspräsident und Reichskanzler der dritte Mann im Staate - mit den Glanzstoff-
Aktien. Er war befreundet mit Fritz Blüthgen, Generaldirektor der Glanzstoff AG. Im
Gewerbegebiet Köln-Niehl, von Adenauer forciert, ließ die Glanzstoff AG ein Zweigwerk
für die Produktion der gerade erfundenen Kunstseide errichten. Bei einem Bankett im
Rathaus, Februar 1928, berichtete Blüthgen, daß Glanzstoff zwei amerikanische Holdings
gegründet habe. Ihren Aktien stehe eine glänzende Entwicklung bevor. Blüthgen verfügte
über einen »Sonderfonds« in Amsterdam. Da dem OB noch eine Million Reichsmark zu den
notwendigen 2,8 Millionen für 7 000 Stück fehlten, sprang Anton Brüning von der
Deutschen Bank ein, in deren Aufsichtsrat der Kölner OB gerade eingerückt war. Brüning
gewährte ihm einen Kredit über 1,18 Millionen, und Adenauer kam über Blüthgens
schwarzen Topf an die 7 000 Aktien, zum Vorzugspreis.
Deutsche Bank als Wahlhelfer
Wie es sich für ein ordentliches Insidergeschäft gehört, handelte auch Brüning
nicht uneigennützig. Er hoffte darauf, der überschuldeten Stadt einen weiteren Kredit
für Adenauers Renommierprojekt Universitätsneubau anzudrehen. Mit diesem Projekt
erhoffte wiederum der OB, seine im November 1929 anstehende Wiederwahl abzusichern. Doch
es kam anders als erwartet. Der Aktienkurs stürzte von 99 auf 25 Dollar ab - Börsencrash
in New York. Die Bank drängte auf Rückzahlung des Kredits. Adenauer wollte nicht zahlen.
Er wollte aber auch angesichts der anstehenden Wahl keinen öffentlichen Skandal um seine
Aktienspekulation. Die Deutsche Bank wollte ebenfalls keinen Skandal, sondern die
Wiederwahl ihres ergiebigen Schuldners. Da die Deutsche Bank Hauptaktionär der Glanzstoff
AG war und den Aufsichtsratsvorsitzenden stellte, griff Freund Blüthgen wieder in seinen
schwarzen Topf. Er füllte das Depot des Oberbürgermeisters bei der Kölner Filiale der
Deutschen Bank mit Aktien im Wert von 1,14 Millionen Mark auf. Dies geschah »leihweise«,
wie es hieß. Der Skandal war vermieden, die Wiederwahl zum Oberbürgermeister ging, mit
knapper Mehrheit, über die Bühne.
Dieser Fall zeigt auch, daß Adenauer seine Insidergeschäfte nicht nebenbei erledigen
ließ, sondern die Einzelschritte intensiv mitverfolgte, einen Teil seiner Dienstzeit und
des öffentlichen Personals dafür nutzte und immer wieder die treibende Kraft spielte. So
schickte er seinem Freund Blüthgen Ende 1928 nach New York, per Adresse Ritz Carlton
Hotel, folgendes Telegramm: »Umtausch schwierig. Bitte mich möglichst bei Neuausgabe zu
beteiligen. Gruß Adenauer«. Der Kölner Oberbürgermeister hatte verfolgt, daß die
Aktien der beiden US-amerikanischen Glanzstoff-Firmen sich unterschiedlich entwickelt
hatten und wollte zwischen ihnen tauschen. Obwohl Glanzstoff-Direktor Blüthgen dafür in
keiner Weise zuständig war, wurde er vom Kölner OB immer wieder gedrängt, seine
Stellung für dessen private Aktiengeschäfte zu nutzen.
Die Insider hielten auch nach 1933 dicht. 1942 aber wurde es brenzlig: Bei der
Glanzstoff-Hauptversammlung trat der Aktionär Dr. Kübel auf. Er verlangte, daß Adenauer
die leihweise überlassenen Aktien zurückgebe, zumal es sich um eine Bestechung gehandelt
habe. Da die Sache publik zu werden drohte, wandte sich Adenauer an Hermann Josef Abs in
Berlin. Der war inzwischen Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und
Aufsichtsratsvorsitzender von Glanzstoff. Adenauer ließ den Hauptmann Schliebusch bei Abs
vorstellig werden. Schliebusch war mit dem ehemaligen Kölner OB vertraut, war er doch
Redakteur der Kölnischen Zeitung aus dem in dieser Hinsicht recht schweigsamen Haus
DuMont Schauberg gewesen und hatte zu Adenauers Geldmanipulationen immer brav nichts
geschrieben.
Schliebusch, nun im Oberkommando der Wehrmacht tätig, überreichte ein Memorandum, in
dem Adenauer darlegte, es habe sich zwar um eine Leihgabe gehandelt. Da aber nicht
ausdrücklich vereinbart worden sei, daß die geliehenen Aktien auch zurückgegeben werden
müßten, »war es augenscheinlich Wille der Parteien, daß ich nichts zurückzugeben
brauchte«.
Auch die NS-Regierung hielt schützend ihre Hand über den »Widerstandskämpfer«.
Durch eine geheime Anweisung wurde den Medien dringend empfohlen, »Ausführungen eines
Dr. Kübel über zurückliegende interne Vorgänge im Konzern der Glanzstoff-Fabriken
nicht zu veröffentlichen«. Adenauer durfte die Aktien behalten. Abs wurde zum
wichtigsten Finanzberater des späteren Bundeskanzlers und ersten CDU- Vorsitzenden.
Letzte Rettung durch die NSDAP
Das Insidergeschäft Adenauers ist in den zahl- und umfangreichen Biografien Adenauers
bisher nur am Rande und nie vollständig dargestellt worden. Das könnte erstaunen. Denn
beim Kauf der 7 000 Glanzstoff-Aktien für 2,8 Millionen Reichsmark setzte Adenauer fast
sein gesamtes Vermögen ein. Das waren nach heutigen Werten über 20 Millionen Mark. Er
war also schon vielfacher Millionär, hatte ein solches Geschäft »eigentlich nicht
nötig«. Darüber hinaus ist zu fragen, warum jemand, der sich als besonders
wirtschaftskompetent begriff und auch heute noch so bewundert wird, sich auf eine so
hochriskante Spekulation einließ. Schließlich zog sich die Auseinandersetzung um
Kreditrückzahlung, Entschädigungsforderungen usw. über zwei Jahrzehnte hin und war auch
1945 nicht beendet. Korrespondenz, Eingaben, Gutachten usw. füllen zahlreiche Aktenbände
und waren Chefsache im Vorstand der Deutschen Bank und der Glanzstoff AG. Trotzdem
herrscht allgemeines Schweigen.
Die schwarze Kasse und die Selbstbedienung aus dem Stadthaushalt wurden bisher in den
Biographien überhaupt nicht erwähnt (mit Ausnahme des Wohngeldes und der
Aufwandsentschädigung).
Dieses Schweigen dürfte nicht zufällig sein. Denn ein Verhalten wie das Adenauers war
nicht nur sein eigenes, sondern wurde von denen gefördert und praktiziert, die zum
»erfolgreichen« kapitalistischen System der 20er und 30er Jahre gehörten: Banken,
Großunternehmen, Börsen. Der Erfolg schien dem in seinem Milieu der Bankiers,
Industriellen, Bischöfe und Spitzenbeamten hochangesehenen Kölner Oberbürgermeister
recht zu geben.
Auch seine gerühmten kommunalpolitischen Glanzprojekte trugen ähnliche Merkmale
seines Handelns wie beim Insiderdeal. Sie waren nicht von betriebswirtschaftlicher
Rationalität, finanzieller Seriosität und sozialer Verantwortung geprägt, sondern von
politischem und finanziellem Abenteurertum. Beispielsweise waren die beiden
Renommierprojekte »Mülheimer Hängebrücke« und »Neubau der Universität« so
terminiert, daß sie genau zum Ende seiner ersten zwölfjährigen Amtszeit 1929 fertig
werden sollten, um ihm die Wiederwahl zu sichern. Gleichzeitig glich die Finanzierung
einem Vabanquespiel mit erheblicher krimineller Energie.
Statt der billigeren Sanierung der alten Universitätsgebäude wollte Adenauer den
Neubau. Damit glaubte er, glänzen zu können, jedenfalls in seinem Milieu. Die
Stadtverordnetenversammlung wollte den teuren Neubau angesichts der hohen städtischen
Verschuldung nicht genehmigen, auch deshalb nicht, weil dann alle Mittel des
Bildungshaushalts auf die Universität konzentriert worden wären, während die
Volksschulen verwahrlosten. Adenauer ließ sich am Tag der Abstimmung durch seinen Freund
Brüning, den Direktor der Deutschen Bank Köln, eine Kreditzusage über zehn Millionen RM
für den Universitätsneubau ins Rathaus schicken. Mit dieser Zusage trat der
Oberbürgermeister vor die Stadtverordneten, die auf dieser überraschenden »Grundlage«
dem Neubau zustimmten. Die Kreditzusage war jedoch eine reine Lüge, der Kredit wurde nie
gewährt, was bei der Haushaltslage der Stadt auch nicht anders sein konnte.
Adenauer war Vorsitzender des Verwaltungsrates der Rheinischen Landesbank. Unterstützt
wurde er von Bankier Hagen, den er in den Verwaltungsrat geholt hatte. 1931 mußte die
Bank ihre Zahlungsunfähigkeit erklären und wurde geschlossen. Sie hatte nicht nur
überproportional viele Kredite an die Stadt Köln vergeben, sondern auch unseriösen
Praktiken zugunsten des Kölner Stadthaushalts zugestimmt.
Ähnlich handelte er mit Hilfe seines politischen Einflusses etwa beim damals
vielberedeten Zehn-Millionen-Kredit der Zentralgenossenschaftsbank »Preussenkasse«.
Dieser angebliche »Überbrückungskredit« hätte von der Preussenkasse nicht vergeben
werden dürfen und wurde nicht zurückgezahlt. Adenauer hielt diese abenteuerliche
Konstruktion in der Schwebe, bis er, nicht nur in dieser Angelegenheit, durch den
Regierungsantritt der NSDAP buchstäblich »gerettet« wurde.
Auch als der Millionenverlust aus dem Insiderdeal feststand, konnte Adenauer keine
Fehler bei sich erkennen. Er bereute nichts. Vielmehr beschuldigte er andere, ihn betrogen
und falsch beraten zu haben. Wie sein politischer Enkel Helmut Kohl stellte Adenauer sich
als Opfer dar, er spielte die verkörperte Unschuld. Dieses Schema wandte er auch auf die
Gesellschaft insgesamt an. 1946 erklärte er im Hinblick auf die Weimarer Republik: »Die
großen äußeren Erfolge, die schnell zunehmende Industrialisierung, die Zusammenballung
großer Menschenmassen in den Städten und ihre damit verbundene Entwurzelung machten den
Weg frei für das verheerende Umsichgreifen der materialistischen Weltanschauung im
deutschen Volk.« 1) Er hätte sich mit der »materialistischen Weltanschauung« selbst
charakterisieren können. Das tat er nicht. Vielmehr klagte er den Nationalsozialismus als
Verkörperung dieser materialistischen Weltanschauung an.
Katholischer Freibrief für Spekulation
Für Adenauer entfalteten die ideologischen und religiösen Bindungen, die er für sich
als christlicher Politiker und Verfechter des Rechtsstaates reklamierte, keine
Hemmungswirkung gegenüber gesetzwidriger Selbstbereicherung. Damit war er freilich nicht
alleine. Vielmehr hatten katholische Theologie und Vatikan die Freibriefe ausgestellt.
Papst Leo XIII. hatte in der Enzyklika »Rerum Novarum« das moderne kapitalistische
Privateigentum ebenso wie das Lohnarbeitsverhältnis mit der christlichen Liebe und
Gerechtigkeit als vereinbar erklärt. Kritische Stimmen wurden aus der katholischen Lehre
verbannt. Das Erzbistum Köln zog 1927 mit seinen »Richtlinien zur sozialen
Verständigung« nach: Die Betätigung in der kapitalistischen Wirtschaft wurde den
Gläubigen schlechterdings freigegeben, als gottgewollt und tugendgemäß bezeichnet.
Schließlich veröffentlichte der später auch in der CDU maßgebliche Theologe, der
Jesuit Nell-Breuning, 1928 seine Schrift »Grundzüge der Börsenmoral« 2). Er
bezeichnete zwar die Börse als »Gelegenheit zur schweren Sünde«, hielt aber
»gegenüber romantisierenden Neigungen gewisser Kreise im katholischen Lager« daran
fest, daß eine »positive Börsenmoral« möglich sei. Wie sie aussehen konnte, hat sein
Förderer und Freund Konrad Adenauer eindrucksvoll vorgelebt.
1) Rede im NWDR am 6. 3. 1946
2) Oswald von Nell-Breuning S.J.: Grundzüge der Börsenmoral. Studien zur katholischen
Sozial- und Wirtschaftsethik, Bd. 4. Freiburg (Herder) 1928.
(Teil 1 erschien am 17. Januar)
Quelle: Junge Welt Politik 18.1.2001
Seitenanfang
Der sechsspurige Ausbau und die
Verlegung der A4 zwischen Düren und Kerpen sind in diesem Investitionsprogramm nicht
enthalten.
Zusätzliche Investitionen zur Beseitigung von
Engpässen im Verkehrsnetz
Gliederung:
1. Warum ein Anti-Stau-Programm?
2. Welche Auswahlkriterien gelten?
3. Welche Maßnahmen ergeben sich?
4. Wie wird das Programm finanziert?
Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Karte
Der Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen,
Reinhard Klimmt, schlägt ein Programm zur Beseitigung von Engpässen im Autobahnnetz, im
Schienenwegenetz und im Netz der Bundeswasserstraßen vor, mit dem über die normalen
Verkehrsinfrastrukturinvestitionen hinaus schnellstmöglich gravierende Engpässe
beseitigt werden.
- Warum ein Anti-Stau-Programm?
Ein funktionierendes, modernes Verkehrssystem – Straße, Schiene, Wasserstraße
– ist eine zentrale Voraussetzung zur Sicherung von Wirtschaftswachstum und
Beschäftigung. Trotz bisheriger hoher Investitionen in die Verkehrsinfrastrukturen gibt
es infolge der Verkehrszunahme weiterhin permanenten Stau auslösende Engpässe, die
früher als es die geltende Finanzplanung erlaubt, beseitigt werden sollen. Nicht nur
Staus, im Autobahnnetz, sondern auch im Schienen- und Wasserstraßennetz führen zu
erheblichen volkswirtschaftlichen Einbußen.
Natürlich werden auch durch die normale Haushaltsfinanzierung Investitionsmittel zur
Beseitigung von Engpässen im Straßen-, Schienen- und Wasserstraßennetz eingesetzt. Aber
diese Investitionen reichen nicht aus, um mittelfristig zu einer signifikanten
Entschärfung der Stausituation zu kommen.
Bundesminister Klimmt hat daher bereits seit seinem Amtsantritt dazu aufgefordert –
auch die Länder – zur Verstärkung der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur
zusätzliche Quellen zu erschließen. Die geplante Verwendung von Einnahmen aus der
streckenbezogenen Gebühr für Lkw ist ein wichtiger Schritt um diese zusätzlichen
Investitionen abzusichern. Das Anti-Stau-Programm ist also ein Programm, dass zusätzliche
Investitionen sozusagen "on top" des Normalprogramms ermöglicht.
Mit dem Anti-Stau-Programm kann nahtlos an die Baumaßnahmen des Investitionsprogramms
1999 bis 2002 angeschlossen werden, das Bundesminister Reinhard Klimmt Anfang November
1999 verkündet hat und das Grundlage für die laufenden Baumaßnahmen ist. Die Mittel des
Anti-Stau-Programms werden ab 2003 verfügbar sein. Die Ankündigung des Programms schafft
jetzt die Planungssicherheit und die erforderliche Zeit zur Erlangung der Baureife der
Projekte, so dass ab 2003 auch mit "Volldampf" gebaut werden kann. Mit
vorbereitenden Arbeiten kann daher sofort begonnen werden.
Das auf 5 Jahre (2003 bis 2007) angelegte Programm ist in der Bundesregierung abgestimmt.
Das Volumen beträgt rd. 7,4 Mrd. DM. Das Programm wird jetzt den Ländern vorgestellt.
- Welche Auswahlkriterien gelten?
Um mit diesen Mitteln die größtmöglichen Wirkungen zu erzielen, erfolgte die
Projektauswahl nach streng objektiven, verkehrstechnischen Kriterien.
Bei den Bundesautobahnen sind es
- überwiegend 4-streifige Autobahnen mit durchschnittlichen
Verkehrsstärken von über 65.000 Kraftfahrzeugen pro Tag, die 6-streifig erweitert werden
müssen,
- Autobahnstrecken mit hohem Lkw-Anteil, fehlenden
Standstreifen und großen Steigungen oder Gefällen,
- das Schließen einiger entscheidender Lücken im Netz, die
bislang regelmäßig zu Staus im vorhandenen Netz geführt haben.
Bei den Bundesschienenwegen bestehen ebenfalls zum Teil
gravierende Engpässe. Bei Engpässen im Schienennetz fahren Züge entweder gar nicht oder
mit starken Verspätungen.
Engpasskriterien sind:
- stark eingeschränkte zulässige Geschwindigkeit, z. B. auf
Grund maroder Bausubstanz oder betrieblichen Zwängen,
- eingleisige Streckenabschnitte mit hoher Zugbelegung
(Flaschenhälse (Bottlenecks)),
- Lücken im Hochgeschwindigkeitsnetz,
- Engpässe in Rangierbahnhöfen und beim Kombinierten
Ladungsverkehr.
Bei den Bundeswasserstraßen sind die Auswahlkriterien
- Strecken mit Sperrungen wegen schlechter Bausubstanz und
Sicherheitsmängeln,
- Strecken mit starker Reduzierung der Leistungsfähigkeit
wegen nicht ausreichender Wassertiefe (Wirtschaftlichkeit der Transporte),
- Streckenabschnitte mit zu hohen Wartezeiten an Schleusen,
Hebewerken bei fehlenden Ausweichmöglichkeiten.
Bei der Auswahl der Projekte nach diesen Kriterien
verbietet sich die Aufnahme nach regionalen oder vergleichbaren Verteilungsmaßstäben.
Die Auswahl der Projekte folgt streng den genannten Kriterien der Engpass- und
Staubeseitigung.
Die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur der neuen Bundesländer werden nach wie vor
auf hohem Niveau und entsprechend der Zusage der Bundesregierung zum Vorrang des
Aufschwung Ost parallel weitergeführt. Ein Beleg dafür sind die erheblichen
Investitionen in die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE) und das Förderprogramm aus
dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).
- Welche Maßnahmen ergeben sich?
Das Anti-Stau-Programm enthält folgende Maßnahmen: Anlagen
1 bis 3
- Wie wird das Programm finanziert?
Die Finanzierung des Programms erfolgt ausschließlich mit zusätzlichen Mitteln, d. h.
die normalen Investitionen laufen ohne Kürzung weiter. Die Mittel kommen aus den ab 2003
verfügbaren Einnahmen aus der streckenbezogenen Autobahngebühr für Lkw, die die heutige
zeitbezogene Straßenbenutzungsgebühr (Eurovignette) ablösen soll.
Anlage 1
Anti-Stau-Programm
Bundesschienenwege
Vorhaben |
Anmer-
kungen |
Volumen
Mio DM |
| Stelle – Lüneburg (3.
Gleis) |
1) |
360 |
Nürnberg – Ebensfeld
(Abschnitt Nürnberg – Forchheim i. Z. mit S-Bahn Nürnberg) |
2) |
400 |
(Roermond-) Grenze –
Mönchengladbach
Eiserner Rhein) |
3) |
50 |
| Düren – Aachen –
Grenze |
4) |
170 |
| KLV/Rbf |
5) |
400 |
| Riesa – Dresden-Neustadt |
6) |
620 |
| Berlin – Dresden |
7) |
500 |
| 2 Zulaufstrecken
Skandinavienverkehr |
8) |
200 |
Ulm – Friedrichshafen –
Lindau
(Begegnungsabschnitt Friedrichshafen – Lindau) |
9) |
100 |
| Gesamt |
|
2.800 |
Anmerkungen:
1) Stelle – Lüneburg: Beseitigung von Engpässen
durch Überlast und damit einhergehender Verspätungsanfälligkeit und Schaffung von
Kapazitäten zur Ausweitung der Verkehre
2) Nürnberg – Ebensfeld: Ermöglichung der Ausweitung
der Verkehre (S-Bahn Nürnberg)
3) (Roermond-) Grenze – Mönchengladbach:
Reaktivierung der Strecke und damit Beseitigung eines Engpasses im
deutsch-niederländisch-belgischen Schienennetz
4) Düren – Aachen – Grenze: Beseitigung von
Engpässen durch Schaffung eines durchgehenden Geschwindigkeitsbandes im internationalen
Verkehr
5) Kombinierter Ladungsverkehr/Rangierbahnhöfe:
Beseitigung von Engpässen in Zugbildungsanlagen Regensburg, Kornwestheim, Frankfurt,
Bebra, Mannheim, Hagen, München, Gremberg, Oberhausen-Osterfeld, Bremen, Seelze, Kassel,
Braunschweig, Halle, Nürnberg, Zwickau
6) Riesa – Dresden: Beseitigung von Engpässen
aufgrund von Langsamfahrstellen durch maroden Streckenzustand und Schaffung von
Kapazitäten zur Ausweitung der Verkehre (S-Bahn Dresden)
7) Berlin – Dresden: Beseitigung von Engpässen
aufgrund von Langsamfahrstellen durch maroden Streckenzustand
8) Zulaufstrecken Skandinavienverkehr: Beseitigung von
Engpässen zur Aufnahme internationaler Verkehre
9) Ulm – Friedrichshafen – Lindau: Beseitigung
eines Engpasses auf einem eingleisigen Streckenabschnitten mit hoher Zugbelegung und
Verspätungsanfälligkeit (Flaschenhals)
Anlage 2
Anti-Stau-Programm
Bundesfernstraßen
| Land |
Straße |
Vorhaben |
Volumen
Mio. DM |
| E=Erweiterung/N=Neubau |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| BW-E |
A 6 |
Viernheim (L-GR
HE/BW) - AK Mannheim |
96,0 |
| BW-E |
A 6 |
AK Walldorf - AS
Wiesloch/Rauenberg |
51,5 |
| BW-E |
A 6 |
AS Sinsheim - AS
Sinsheim/Steinsfurt (B 39) |
80,4 |
| BW-E |
A 6 |
AS
Sinsheim/Steinsfurt - AS Bad Rappenau |
51,9 |
| BW-E |
A 6 |
AS Bad Rappenau - AS
Heilbronn/Untereisesheim |
67,6 |
| BW-E |
A 6 |
AS
Heilbronn/Untereisesheim – AK Weinsberg |
144,2 |
| BW-E |
A 8 |
AS Heimsheim -
Leonberg-West (B 295) |
164,8 |
| BW-E |
A 8 |
Umbau AS
Stuttgart/Degerloch (mit B 27 Möhringen /Echterdingen) |
98,9 |
|
|
SUMME BW |
755,3 |
| BY-E |
A 8 |
Augsburg-West –
Derching |
58,7 |
| BY-N |
A 7 |
AS Nesselwang –
Füssen |
161,3 |
| BY-N |
A 94 |
Ampfing-Ost –
Erharting |
84,7 |
| BY-N |
A 99 |
Langwied –
Unterpfaffenhofen |
272,2 |
|
|
SUMME BY |
576,9 |
|
|
|
|
| HE-N |
A 66 |
Frankfurt/Erlenbruch
- AS Frankfurt/Berken-Enkheim |
320,0 |
|
|
|
|
| NI-E |
A 1 |
AS Osnabrück-Nord -
AK Lotte/Osnabrück |
71,0 |
| NI-E |
A 7 |
AD Hannover-Nord - AS
Großburgwedel |
61,1 |
| NI-E |
A 7 |
Umbau AK Hannover-Ost |
17,3 |
| NI-E |
A 7 |
AS Göttingen - AS
Friedland |
93,9 |
|
|
SUMME NI |
243,3 |
| NW-E |
A 1 |
LGr. NW/NS - AK
Lotte/Osnabrück |
48,2 |
| NW-E |
A 1 |
Umbau AK
Münster-Süd |
28,9 |
| NW-E |
A 1 |
AK
Westhofen - AS Hagen-Nord |
171,6 |
| NW-E |
A 1 |
AK
Köln-Nord - DB-Strecke Köln-Aachen |
158,5 |
| NW-E |
A 3 |
AS
Köln/Mühlheim - AK Köln-Ost |
89,0 |
| NW-E |
A 3 |
AK
Köln- Ost - Griesinger Straße |
135,4 |
| NW-E |
A 4 |
AK
Kerpen - AK Köln- West |
144,7 |
| NW-E |
A 40 |
AS Gelsenkirchen - B
227 |
22,6 |
| NW-E |
A 40 |
B 227- AS
Bochum-Stahlhausen |
59,0 |
| NW-E |
A 40 |
AS Bochum-Stahlhausen
(Westring) |
75,0 |
| NW-E |
A 46 |
AS Haan-Ost –
Westring |
16,9 |
| NW-E |
A 46 |
Westring - AK
Sonnborn (L 418) |
20,1 |
| NW-E |
A 57 |
AK Strümp (A 44) -
AK Kaarst (A 52) |
47,2 |
| NW-E |
A 57 |
AK Kaarst (A 52) - AS
Neuss-West |
44,0 |
| NW-E |
A 57 |
Umbau AS Neuss-West |
60,2 |
| NW-N |
A 44 |
Bochum (L 705) - AK
Bochum/Witten (A 43) |
79,4 |
|
|
SUMME NW |
1200,7 |
| RP-E |
A 60 |
AK Mainz-Süd - AS
Laubenheim |
202,8 |
| RP-N |
A 63 |
AS Sembach - AS
Kaiserslautern-Ost |
95,6 |
|
|
SUMME RP |
298,4 |
| SN-N |
A 38 |
AS Knautnaundorf (B
186) - AS Gaschwitz (B 2/B 95) |
224,0 |
| SH-N |
A 21 |
Bornvöved -
Negernbötel (B 205) (Ausbau 2 auf 4 Fahrstreifen) |
57,7 |
|
|
Gesamt |
3677 |
= rd. 3,7 Mrd.DM
Anlage 3
Anti-Stau-Programm
Bundeswasserstraßen
| Vorhaben |
Volumen
Mio. DM |
Anmer-
kungen |
Baurecht
(derzeitiger Stand) |
| Dortmund – Ems –
Kanal (Südstrecke) als Teil der Ost – West Wasserstraßenverbindung (Ausbau) |
250 |
1) 2) |
z. T. vorh., in
Vorber. |
| 2 Abschnitte: VDE 17 als Teil
der Ost – West – Wasserstraßenverbinung (Ausbau) |
250 |
1) 2) |
z. T vorh., in
Vorber. |
| Schiffshebewerk Niederfinow
(Neubau, 1. Bauabschnitt) |
180 |
3) |
noch nicht
vorhanden |
| 2 Zweite Moselschleusen
(Neubau) |
180 |
3) |
in Vorber. |
| Schleuse Lauenburg (Neubau) |
40 |
1) |
in Vorber. |
| Gesamt |
900 |
|
|
Anmerkungen:
1) Streckenabschnitte mit
Standsicherheitsgefahr/Streckensperrung
2) Streckenabschnitte mit gravierender Reduzierung der
Leistungsfähigkeit, Richtungsverkehren, Abladebeschränkungen, unwirtschaftlicher
Schiffsverkehr
3) Streckenabschnitte mit Staus/hohen Wartezeiten an
Schleusen/Hebewerken wegen hohen Verkehrsaufkommens und unvermeidbaren Sperrungen wegen
Reparaturarbeiten
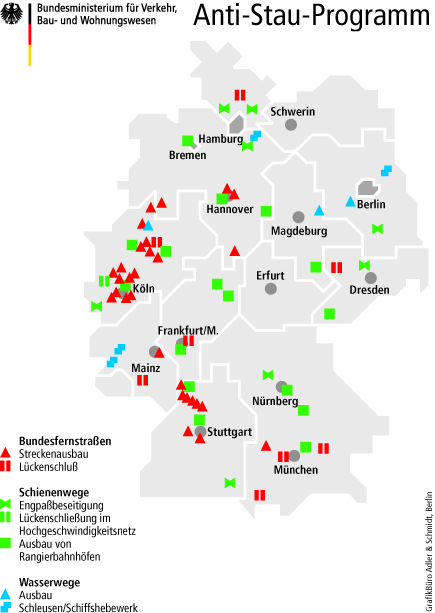
Seitenanfang
Neues Fördergesetz soll
die Kraft-Wärme-Kopplung retten
Bonusregelung unterstützt vor allem kommunale Kraftwerke -
Koalition will Anteil des KWK-Stroms bis 2010 verdoppeln
Der Bundestag hat am Freitag mit den Stimmen der Koalition
ein Sofortprogramm zur Rettung der umweltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung verabschiedet.
Mit einer Bonusregelung sollen vor allem die kommunalen Kraftwerke unterstützt werden,
die mithilfe der so genannten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Strom und Wärme produzieren.
Wegen ihrer hohen Energieeffizienz gilt die KWK als besonders klimafreundlich. KWK-Strom
hält an der deutschen Stromversorgung derzeit noch einen Anteil von zwölf Prozent. Als
Folge der Liberalisierung des deutschen Strommarktes stehen die KWK-Anlagen aber unter
einem massiven Wettbewerbsdruck. Durch den Preiskampf unter den
Energieversorgungsunternehmen (EVU) sind die Strompreise um mehr als die Hälfte gefallen.
Während Strom aus Kondensations- oder Atomkraftwerken für unter vier Pfennig pro
Kilowattstunde angeboten wird, kostet KWK-Strom bis zu zehn Pfennig. "Die
Energieversorger verdrängen die Kraft-Wärme-Kopplung mit Dumpingpreisen vom Markt. Ohne
eine sofortige Unterstützung droht diese umweltfreundliche Energieerzeugung vollständig
zusammenzubrechen", sagte der SPD-Energiepolitiker Hermann Scheer.
Das so genannte KWK-Vorschaltgesetz tritt am 1. April in Kraft. Es sieht vor, alle Anlagen
in die Förderung einzubeziehen, die KWK-Strom in das öffentliche Netz einspeisen. Von
der Förderung sollen nur industrielle Anlagen ausgenommen werden. Die EVU sind
verpflichtet, KWK-Strom in das Versorgungsnetz einzuspeisen und den Strom mit neun Pfennig
pro Kilowattstunde zu vergüten. Damit erhält KWK-Strom im ersten Jahr einen Bonus von
drei Pfennig pro Kilowattstunde. Die Einspeiseregelung ist auf fünf Jahre beschränkt und
wird jedes Jahr um 0,5 Pfennig fallen. Die Mehrkosten von zunächst 0,2 Pfennig pro
Kilowattstunde sollen auf alle Stromkunden umgelegt werden. Der energiepolitische Sprecher
der SPD-Fraktion, Volker Jung, betonte, die Kraft-Wärme-Kopplung sei eine
"ökologisch sinnvolle und wirtschaftlich vernünftige Energieerzeugungsart".
Mit dem Gesetz werde ihr eine Chance gegeben, sich den dramatisch veränderten
Marktbedingungen schrittweise anzupassen. Die Opposition lehnte das Förderprogramm
hingegen ab, da es die Bürger erneut mit höheren Preisen belaste. Für etliche Anlagen
kommt das Sofortprogramm bereits zu spät. Mehrere Stadtwerke haben in den vergangenen
Monaten damit begonnen, ältere KWK-Anlagen stillzulegen. Nach Angaben des Verbandes
kommunaler Unternehmen (VKU) produzieren die Stadtwerke den Hauptteil ihres Stroms in
KWK-Anlagen. "Mehrere 100 Megawatt Leistung sind in den letzten Monaten schon vom
Netz gegangen", teilte Heiner Müller vom Vorstand des VKU der WELT mit. "Ohne
die jetzige Förderung sind 20 000 Arbeitsplätze bei den Stadtwerken in akuter
Gefahr." Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) kritisierte
hingegen die neue Gesetzesregelung. "Die industrielle Kraft-Wärme-Kopplung trägt
heute über die Hälfte zum gesamten KWK-Strom in Deutschland bei", sagte
VIK-Sprecher Roland Schmied. Dass die Politik die Förderung der KWK-Technologie von den
Eigentümerverhältnissen der Anlagen abhängig mache, sei ungerecht und ökologisch
kontraproduktiv. Im Unterschied zu den kommunalen KWK-Anlagen, bei denen der Wärmeabsatz
ein saisonales Geschäft ist, sind die industriellen Anlagen das ganze Jahr über im
Einsatz, um Prozesswärme für die Industrie zu liefern. Die Anlagen sind vom
Strompreisverfall daher nicht so stark betroffen. Die Bundesregierung will bis Ende des
Jahres eine endgültige Gesetzesregelung zum Ausbau der KWK verabschieden, die alle
Betroffenen berücksichtigt. Ziel ist eine Verdoppelung des KWK-Stroms bis zum Jahr 2010.
Der VKU und der VIK wie auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
fordern dazu die Aufstellung einer festen Förderquote. Die energiepolitische Sprecherin
der Grünen, Michaele Hustedt, favorisiert eine Quotenregelung auf der Basis handelbarer
Zertifikate. Damit könnten alle KWK-Anlagen unabhängig von der
Eigentümerschaft in die Förderung einbezogen werden. "Ein Quotenmodell ermöglicht
es, KWK-Strom wettbewerbsneutral zu fördern und gleichzeitig eine Förderung auf
europäischer Ebene anzustoßen", sagte Hustedt der WELT. Der EU-Ministerrat
hatte noch im Dezember 1999 eine EU-weite Verdoppelung des KWK-Stroms gefordert und die
nationalen Regierungen zu größeren Anstrengungen angemahnt.
Quelle: Welt, Die 24.3.2000
Seitenanfang
Zertifizierung
von Ökostrom: Der "Label-Boom". Drei Ansätze im Vergleich.
Freiburg, April 2000
Es gibt in Deutschland verschiedene Initiativen und
Ansätze zur Zertifizierung von Ökostrom. Gütesiegel sollen dazu beitragen,
Markttransparenz auf dem (grünen) Strommarkt herzustellen. Die drei fortgeschrittensten
Zertifizierungsverfahren sollen im Folgenden einander gegenübergestellt werden. Die
zentralen Aspekte und Unterschiede sind in der Tabelle zusammengefasst (siehe Seite 5).
TÜV
Die Technischen Überwachungs-Vereine (TÜV) haben eine
Richtlinie zur Vergabe eines Zertifikats für die "Bereitstellung von Strom aus
erneuerbaren Energien" erarbeitet (12-Punkte-Kriterienkatalog). Ziel
des Zertifikats ist vorrangig der Nachweis, dass die Kunden das bekommen, was der Anbieter
verspricht. In diesem Sinne werden auch außerhalb der Richtlinie Stromangebote
zertifiziert, darunter z.B. Mischangebote, die auch Strom aus gasbefeuerten
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen beinhalten.
Grüner Strom Label
Verschiedene Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutzverbände
haben den Grüner Strom Label e.V. gegründet, um ein zweistufiges Gütesiegel für
Ökostrom zu vergeben. Die Anforderungen für das Gold- bzw. Silber-Label sind im
"Kriterienkatalog für die Zertifizierung von Grünem Strom" zusammengefasst.
Neben dem Produkt werden auch die Anbieter selbst in die Bewertung einbezogen: Sie dürfen
insbesondere keine Atomkraftwerke betreiben - es sei denn, es wurde ein Ausstiegsbeschluss
gefasst. Was "Ausstiegsbeschluss" bedeutet, wird allerdings nicht definiert. Die
Anforderungen an die Anbieter wurden Ende letzten Jahres deutlich abgeschwächt.
Öko-Institut
Das Öko-Institut hat im Auftrag der Bremer Energie-Konsens
GmbH ein eigenes Zertifizierungsverfahren entwickelt, auf dessen Basis ein Gütesiegel mit
zwei Produktklassen vergeben werden kann. Die Anbieter selbst werden nicht bewertet. Dies
sollte nach unserer Auffassung an anderer Stelle geschehen.
Bisher wurde das Gütesiegel der Produktklasse
"regenerativ" für drei Ökostrom-Angebote vergeben:
- "Nahstrom - Naturstrom aus Kassel" der
Städtischen Werke AG, Kassel,
- "Terra" der MVV Energie AG, Mannheim, sowie
- "ÖkoPur" der Bewag AG, Berlin.
Bewertung weiterer Unterschiede
Im Grundsatz sind sich alle drei
Zertifizierungs-Institutionen darin einig, dass die Energiewende nur durch den Neubau
umweltschonender Anlagen vorangebracht werden kann. Das TÜV-Zertifikat stellt hierzu
jedoch keine ernst zu nehmenden Anforderungen und nimmt keinerlei Abgrenzung zum
Erneuerbare-Energien-Gesetz vor (EEG; bisher Stromeinspeisungsgesetz). Anlagen, für die
die gesetzliche Vergütung nach EEG in Anspruch genommen wird, sind sogar ausdrücklich
zugelassen. Dies sind gravierende Mängel des TÜV-Verfahrens.
Während sich die TÜV-Richtlinie auf erneuerbare Energien
(REG) beschränkt, unterscheidet sich die Grundphilosophie des Label e.V. bezüglich der
förderwürdigen Stromerzeugungsanlagen und Energieträger nicht wesentlich von unserer
Position. Neben erneuerbaren Energien wird effiziente Kraft-Wärme-Kopplung zugelassen.
Unterschiede gibt es im Detail. Bezüglich Neuanlagen bzw. Zubau stellen beide
Zertifizierungsverfahren klare Anforderungen. Die Implementierung erfolgt aber
unterschiedlich. Gütesiegel des Label e.V. setzen eine bestimmte jährliche Zubauquote
voraus ("Händlermodell"). Bei unserem Verfahren führt die Minderungsquote bei
den Treibhausgasemissionen automatisch zu einem hohen bis sehr hohen Anteil an Neuanlagen.
Ein in dieser Form quantifiziertes Umweltziel findet sich weder beim TÜV noch beim Label
e.V. Wenn der Ökostrom zum Beispiel mit Hilfe von Wind-, Wasser- und Sonnenenergie
erzeugt wird, ist ein Neuanlagenanteil von über 75% erforderlich, um das
Reduktions-Kriterium des Gütesiegels "regenerativ" zu erfüllen.
Ebenso wie wir sieht der Label e.V. den Handel mit Grünem
Strom als Ergänzung zu anderen Förderinstrumenten für den Ausbau der grünen
Stromerzeugung. Wir stimmen insbesondere darin überein, dass Handel und Zertifizierung
von Grünem Strom die Ziele und Wirkungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes nicht
unterlaufen dürfen. Netzbetreiber dürfen nicht aus ihrer gesetzlichen Pflicht zur
Mindestvergütung von regenerativ erzeugtem Strom entlassen werden. Unsere
Zertifizierungskriterien setzen diese Idee konsequent um (Vorrang für das EEG, klare
Anteilsregelung bei Zusatzvergütung). Beim Gütesiegel des Label e.V. gilt diese Aussage
nur eingeschränkt.
"Zuschussmodell" des Label e.V
Die Abgrenzung zum EEG (früher StrEG) wird vom Label e.V.
nicht gefordert, wenn Ökostrom nach dem "Zuschussmodell" angeboten und verkauft
wird. Bei diesem Modell beziehen die Kunden konventionellen Strom, leisten dem Anbieter
jedoch regelmäßige Zahlungen, die dieser für die Finanzierung von REG-Strom- bzw.
KWK-Anlagen verwendet. Die einzige Bedingung für die Erteilung des Grüner-Strom-Labels
lautet dann, dass mindestens 75% dieser Zahlungen in die Förderung neuer
- eigener oder fremder - Anlagen fließen, die nur auf diese Weise wirtschaftlich
betrieben werden können. Die Kriterien des Label e.V. schreiben dabei keine Zeitspanne
vor, in der die neuen Anlagen in Betrieb gehen müssen. Auch die erzeugte Strommenge
unterliegt keinen Vorgaben.
Die Naturstrom AG z.B., die als erste das Gold-Label
erhielt, gewährt verschiedenen Stromerzeugern einen Zuschuss zusätzlich zur gesetzlichen
Einspeisevergütung. Die gesamte in diesen Anlagen erzeugte Strommenge wird dann von
diesem Anbieter als Ökostrom vermarktet. Die Tatsache, dass ein wesentlicher Teil der
Finanzierung durch die Allgemeinheit der Stromverbraucher getragen wird, wird ignoriert
(Umlage der gesetzlichen Vergütung). Gleiches gilt für den "Ökostrom-Pool"
der ASEW, dessen Strommarken "energreen" bzw. "etagreen" kürzlich das
Goldene bzw. Silberne Label des Grüner Strom Label e.V. erhielten.
Diese Art der Förderung erneuerbarer Energien ist
unterstützenswert, weil sie als "Spenden- und Zuschussmodell" betrachtet
werden kann. Sie sollte auch solches dargestellt werden. Die Veröffentlichungen der
Anbieter sind in diesem Punkt nicht ganz ehrlich und für Unkundige nicht transparent.
Zwei Schlussbemerkungen
- Nur ein Gütesiegel, dessen Vergabe an den Neubau
umweltschonender Stromerzeugungsanlagen geknüpft ist, das eine Doppelvermarktung von
Ökostrom ausschließt und bei Anbietern und Kunden auf hohe Akzeptanz stösst, kann einen
Beitrag zur Energiewende leisten.
- Welche Auswirkungen das ab 1.4.2000 geltende
Erneuerbare-Energien-Gesetz auf den "Grünen Strommarkt" haben wird, bleibt
abzuwarten. Der nach diesem Gesetz bundesweit aus alten und neuen Anlagen eingespeiste
Strom muss zukünftig von allen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an
Letztverbraucher liefern, anteilig abgenommen und vergütet werden. Sie dürfen ihren
Anteil an diesem Strommix als Regenerativstrom verkaufen, allerdings zu Preisen, die nicht
unter den durchschnittlichen Vergütungssätzen für Strom aus erneuerbaren Energien
liegen. Das EEG berücksichtigt aber nicht die Möglichkeit zusätzlicher, freiwilliger
Zuschüsse an Anlagenbetreiber. Auf diese Weise kann es zukünftig durch Doppelvermarktung
von so genanntem Ökostrom zu verschärften Konflikten kommen.
Wichtigste Aspekte und Unterschiede verschiedener
Zertifizierungsansätze
| |
TÜV |
Grüner
Strom Label |
Öko-Institut |
| |
|
"Zuschussmodell" |
"Händlermodell" |
|
| Bewertungs-objekt |
Produkt |
Produkt
und Anbieter |
Produkt |
| Gütesiegel |
Zertifikat ohne
Abstufungen |
2-stufiges
Gütesiegel |
Gütesiegel mit
2 Produktklassen |
| Strommix |
100% REG |
100%
REG (davon 1% PV) - oder -
mindestens 50% REG (davon 1% PV) + KWK fossil |
| Minderung der Treibhausgas-(THG-)
emissionen |
keine
quantifizierte Forderung |
75% bzw. 50%
gegenüber modernem Steinkohle-Kraftwerk (à Neuanlagen) |
| weitere ökologische
Anforderungen |
ja;
teilweise unterschiedlich |
| Neuanlagen / Zubau |
keine Bedingung
|
mindestens 75%
der regelmäßigen Kundenzahlungen fließen in die Förderung neuer Anlagen |
jährliche
REG-Zubauquote
(10% des Vorjahres) |
zusätzlich zur
Bedingung aus THG-Reduktion: mind. 25% REG- Neuanlagen, davon 1% PV |
| Abgrenzung zum
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) |
nein |
nein |
teilweise |
Vorrang für
EEG |
bei
Zusatzvergütung gilt spezielle Anteilsregelung |
| Zeitgleichheit von Erzeugung und
Verbrauch |
nur bei
"Vollversorgung" |
Jahresbilanz |
"zeitnahe
Liefe-rung" zunächst ausgesetzt |
Jahresbilanz |
| Zertifikate bisher |
mehrere |
zwei |
keines |
drei |
Quelle: Öko-Institut e.V.
Institut für angewandte Ökologie, Geschäftsstelle
Freiburg, Postfach 6226, D-79038 Freiburg
http://www.oeko.de/deutsch/energie/label.htm
Seitenanfang
Inzwischen gibt es drei verschiedene Labels für Grünen
Strom, die den Verbrauchern Sicherheit geben sollen.
Das klappt jedoch nicht immer. In einem Fall wurde über Umwege sogar Atomstrom als
"grün" zertifiziert
"Der eine Strom ist grün, der andere Strom aber noch
grüner, wie will man das noch vermitteln?", schimpft Sven Teske von der
Energie-Kampagne bei der Umweltorganisation Greenpeace, zuständig für die
Qualitätskontrolle des eigenen Ökostrom-Angebots "Greenpeace energy".
Zurzeit gibt es drei Verbände, die Ökostrom
zertifizieren, künftig werden noch weitere Institute und Vereine dazustoßen.
Schließlich gibt es auch Geld zu verdienen, je nach Zertifikat und Prüfinstitut schnell
zehntausend Mark und mehr. Hinzu kommt, dass die Verbände oft nicht nur ein Label
vergeben, sondern Abstufungen, beispielsweise in Ökostrom Güteklasse
"regenerativ" und "effektiv" oder "Gold" und
"Silber", vornehmen. "Wir haben schon Schwierigkeiten, zu erklären, warum
Billigstrom schlecht ist", erzählt Teske. Die sich anbahnende Label-Schwemme hält
er für Unfug.
Zertifikate erteilen inzwischen die zahlreichen
TÜV-Gesellschaften, der Grüner Strom Label e. V. und das Öko-Institut. Vereinzelt
zertifiziert haben auch schon das Forschungszentrum Rossendorf, das Fraunhofer-Institut in
Freiburg und der World Wide Fund for Nature, diese jedoch im Vergleich zu Erstgenannten
ohne erkennbaren Ehrgeiz, ihr eigenes Zertifikat als wichtigstes Gütesiegel zu
etablieren. Am interessantesten erscheint da noch der Ansatz des Umweltbundesamtes. Bis
spätestens Mai sollen die Kriterien für die Vergabe eines Blauen Engels für Ökostrom
feststehen. Teske hofft, dass der Blaue Engel dem Labelchaos ein Ende bereitet und sich
mit der Zeit als verlässliches Gütesiegel durchsetzt.
Der TÜV oder besser die im Verband der Technischen
Überwachungs-Vereine e. V. zusammengeschlossenen eigenständigen und unabhängigen
TÜV-Gesellschaften haben bereits die ersten neun Unternehmen zertifiziert. Hierzu
gehören die Stadtwerke Herne, aber auch die RWE Energie AG mit ihrem Umwelttarif.
Zahlreiche Unternehmen befinden sich gerade im Zertifizierungsprozess und hausieren
bereits mit dem zu erwartenden Zerifikat. Die Hoffnung auf einen positiven
Prüfungsbescheid dürfte bei den meisten Antragstellern berechtigt sein. Denn der TÜV
prüft lediglich, "ob die Kunden bekommen, was das Unternehmen verspricht", so
Wolfgang Wiesner vom TÜV Rheinland, der unter anderem auch die Stadtwerke Herne geprüft
hat. "Auch Brunsbüttel ist TÜV-geprüft," gibt Cornelia Steinecke von
Greenpeace energy zu bedenken. Zwar nach der Richtlinie für Atomkraftwerke und nicht nach
der für Ökostrom-Anbieter, aber darauf muss der Verbraucher selber achten.
In der Vergaberichtlinie für ein TÜV-Zertifikat
"Bereitstellung von Strom aus erneuerbaren Energien" ist unter anderem
festgelegt, welche Energieform als "erneuerbar" gilt. Hierzu zählt neben Solar-
und Windenergie auch Deponiegas, dessen Aufnahme Wiesner mit Klimaschutzgründen
rechtfertigt. Fossile Energiequellen, auch wenn diese vergleichsweise umweltverträglich
in Kraft-Wärme-gekoppelten Anlagen verstromt werden, zählen nicht dazu, anders als
beispielsweise bei den Gütesiegeln des Öko-Instituts oder von Grüner Strom Label e. V.
Als Besonderheit und im Unterschied zu allen anderen Zertifikaten bietet der TÜV ein
Zertifikat für eine Vollversorgung und eine Teilversorgung an. Bei der Vollversorgung
muss der Ökostrom zeitgleich bereitgestellt werden, bei der Teilversorgung reicht die
Erzeugung der benötigten Energiemenge zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb Jahresfrist
aus.
Im Auftrag der Bremer Energiekonsens GmbH - gegründet 1997
unter anderem von der PreussenElektra - hat das Öko-Institut e. V. ein zweistufiges
Gütesiegel-Konzept entwickelt. Wichtiges Kriterium: Es sollen neue Anlagen gebaut werden.
Als neu gilt jede Anlage, die "nach dem 31. Dezember 1997 in Betrieb gegangen
ist", wie es im Endbericht der Arbeitsgruppe definiert ist. Und um es noch
komplizierter zu machen, gelten ältere Anlagen anteilig als neu, bei Inbetriebnahme im
Jahr 1995 beispielsweise zu 25 Prozent. Ein besonderes Anliegen ist dem Öko-Institut die
Vermeidung von "Lastverschiebungen", das heißt, dass Mehrkosten aus dem
Stromeinspeisungsgesetz nicht von der Allgemeinheit auf die freiwilligen Grünstrom-Kunden
verlagert werden. Strom, der bereits über das Stromeinspeisungsgesetz finanziert wurde,
darf beim Öko-Instituts-Siegel nicht noch ein zweites Mal als Ökostrom vermarktet
werden. Beim TÜV wäre dies kein Problem. Dafür erlaubt das Öko-Institut die Nutzung
von Erdgas und sogar Steinkohle zu Erzeugung von Ökostrom.
Das Gütesiegel kennzeichnet zwei Klassen von
umweltschonenden Stromangeboten: Die Klasse "effektiv" besteht zu mindestens 50
Prozent aus erneuerbaren Energien, der Rest stammt aus umweltfreundlicher
Kraft-Wärme-Kopplung. Die Klasse "regenerativ" besteht zu 100 Prozent aus
erneuerbaren Energien. Beiden Klassen ist gemein, dass mindestens 1 Prozent des Stroms aus
Solarstromanlagen stammt. Als erster Anbieter haben Ende Dezember die Städtischen Werke
AG, Kassel, das Gütesiegel der Produktklasse "regenerativ" erhalten.
Wieder ein anderes Konzept verfolgt Grüner Strom Label e.
V., ein von der Solarorganisation Eurosolar ins Leben gerufener Verein. Die Kriterien sind
auf den ersten Blick ähnlich wie beim Öko-Institut. Strom aus Blockheizkraftwerken ist
erlaubt, führt aber zu einem Siegel für nicht ganz so grünen Strom, genannt
"Silbernes Label". Wer Gold erhalten möchte, muss auf ausschließlich
erneuerbare Energien zurückgreifen.
Wichtigster Unterschied zu den beiden vorgenannten
Zertifizierungsstellen: Neben dem Produkt Ökostrom wird auch der Anbieter in die Prüfung
mit einbezogen. Unternehmen, die mit Kohle und Atomstrom
produzierenden Muttergesellschaften verbunden sind oder gar selbst derart
umweltschädlichen Strom vermarkten, sind nach Auffassung des Vereins Grüner Strom Label
keine glaubwürdigen Förderer der erneuerbaren Energien und sollten ursprünglich kein
Siegel erhalten können. "Das Definitionsmerkmal "Produzent von Grünem
Strom" findet auf keinen Produzenten Anwendung, der Strom in Atomkraftwerke,
Braunkohlekraftwerke oder fossile Kondensationskraftwerke liefert oder mit einem solchen
Produzenten verflochten ist", hieß es in den Definitionsmerkmalen vom April
1998. Im Dezember des gleichen Jahres wurde nur noch verlangt, dass "kein
Anteilseigner [an einem Ökostrom-Anbieter], der über eine Sperrminorität verfügt,
Atomkraftwerke betreiben darf". Und wenn doch, soll er zumindest "seinen
zeitlich konkretisierten Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen haben".
Eine weitere Verwässerung der einst kompromisslosen
Vergabekriterien gab es schließlich in der Fassung vom 27. Dezember letzten Jahres.
Ursprünglich sollten nur Unternehmen zertifiziert werden, die "den Stromkunden die
ausschließliche und zum Verbrauch zeitnahe Lieferung des Grünen Stroms garantieren"
können. In der aktuellen Fassung gibt es hierzu eine Ausnahmeregelung, von einem
Ökostrom-Anbieter erbost als "Lex Naturstrom AG" tituliert: "Der Kunde
bezieht konventionellen Strom, leistet aber dem Anbieter regelmäßig Zahlungen, die
dieser für die Finanzierung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energiequellen verwendet." Die Naturstrom AG hätte ohne diese Erweiterung der
Vergabekriterien das Label nicht bekommen, da sie aus Kostengründen auf eine zeitnahe
Bilanzierung verzichtet. So jedoch haben die Düsseldorfer marketingwirksam Anfang
Dezember als Erste das Grüner Strom Label erhalten können. Das zweite Label ist bereits
für das Angebot energreen der ASEW reserviert, eines Zusammenschlusses von rund 200
Stadtwerken. Peinliche Panne: Energreen wird auch von den Stadtwerken Bielefeld
vertrieben. Und diese sind Mitbetreiber der KWG Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH.
Einziger Kommentar des Vorsitzenden des Zertifizierungsausschusses, Klaus Traube:
"Das habe ich noch gar nicht gemerkt. Bitte machen Sie da keine große Geschichte
draus."
siehe auch Umweltlinks
Quelle: TAZ 28.1.2000
Seitenanfang
Stromhandelszonen
in Deutschland
Handelszone Nord = gelb
Handelszone Süd = grün

Seitenanfang
Alte und neue
Verbändevereinbarung im Vergleich
Der Gesetzgeber hat im neuen Energiewirtschaftsgesetz die
konkrete Ausgestaltung der Netzzugangsregelungen den Verbänden VDEW, BDI und VIK in Form
einer sogenannten Verbändevereinbarung überlassen. Die Verbändevereinbarung beinhaltet
Regelungen für die Entgeltberechnung sowie für die Organisation und den Ablauf des
Netzzugangs. Da die Verbändevereinbarung eine freiwillige Vereinbarung der drei genannten
Verbände ist, hat sie allerdings keine unmittelbare rechtliche Verbindlichkeit.
Die alte Verbändevereinbarung wurde im Mai 1998
abgeschlossen und im Januar 2000 durch eine neue Verbändevereinbarung
(Verbändevereinbarung II) ersetzt. Die Eckpunkte der alten und neuen
Verbändevereinbarung werden im folgenden erläutert.
- Die Durchleitungspreise werden auf der Basis der
kalkulatorischen Kosten berechnet. Die Kalkulation wird dem Verfahren angelehnt, nach dem
Energieversorger bisher ihre Stromtarife berechnet und den Länderbehörden zur
Genehmigung vorgelegt haben. An dem Prinzip der kostendeckenden Entgeltgestaltung wird
somit festgehalten. In der neuen Verbändevereinbarung ist zusätzlich zur
Entgeltermittlung auf Kostenbasis das Vergleichsmarktprinzip eingeführt worden, um auch
im Netzbetrieb Anreize zur Rationalisierung und Kosteneffektivität zu verstärken. Hierzu
sollen die Entgelte verschiedener Netzbetreiber strukturell vergleichbarer
Versorgungsgebiete gegenübergestellt werden. Die Kriterien für strukturell vergleichbare
Versorgungsgebiete und der Ablauf des Entgeltvergleichs sind in der neuen
Verbändevereinbarung nicht näher definiert, so daß unklar bleibt, welche Auswirkungen
sich aus der Einführung des Vergleichsmarktprinzips ergeben.
- Die Netze jedes Netzbetreibers werden entsprechend den
Spannungsebenen in Höchst-, Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetze als Netzbereiche
eingeteilt. Zwischen den genannten Spannungsebenen werden die jeweiligen Umspannungen
ebenfalls als weitere Netzbereiche definiert. Für jeden dieser Netzbereiche wird ein
festes spezifisches Durchleitungs- bzw. Netzzugangsentgelt in Form von Jahresleistungspreisen
gebildet.
Gemäß alter
Verbändevereinbarung mußte jede genutzte Spannungsebene nureinmal, und zwar auf der
Abnehmerseite, gezahlt werden, auch wenn sie bei Einspeisung und bei Abnahme genutzt (Abnahmeprinzip). Wurde in das Niederspannungsnetz
eingespeist, jedoch aus einem Mittelspannungsnetz entnommen, fielen keine Kosten für das
Niederspannungsnetz sowie für die Umspannung von Nieder- auf Mittelspannung an. Innerhalb
eines Netzbereiches war das Entgelt in der Regel ortsunabhängig, weshalb die
Netzbereichsentgelte auch "Briefmarken" genannt werden. Lediglich im
Höchstspannungsnetz war für Luftlinienentfernungen zwischen Einspeiser und Abnehmer von
über 100km eine zusätzliche entfernungsabhängige Komponente (0,125
DM/kW \ km \ a) zu zahlen. Dies hat die Durchleitungsentgelte stark in
die Höhe getrieben und vielfach den Strombezug aus der näheren Umgebung bevorteilt.
Damit wurden insbesondere Lieferanten behindert, die nur wenige Erzeugungsanlagen und
davon weit entfernte Kunden haben.
Als genutzte Spannungsebenen wurde hierbei nicht der
physikalische Leitungsweg betrachtet, sondern die Luftlinienentfernung
zwischen Abnehmer und Einspeiser. Danach galt eine höhere Spannungsebene dann als
in Anspruch genommen, wenn die Luftlinie zwischen Abnehmer und Einspeiser eine bestimmte
Grenzentfernung überschritten hat. Dann mußte die Briefmarke für die nächsthöhere
Spannungsebene sowie für die dazugehörige Umspannung bezahlt werden. Die Grenzentfernungen, nach der jeweils die Nutzung des
nächsten Netzbereiches unterstellt werden, waren zwischen Stadt und Land differenziert.
Innerhalb eines Stadtgebietes mußte bereits nach kürzeren Entfernungen als in
ländlichen Regionen die nächsthöhere Spannungsebene bezahlt werden.
Die neue Verbändevereinbarung hat anstelle der
transaktionsbezogenen Ermittlung von genutzten Spannungsebenen einen Netz-Punkt-Tarif eingeführt. Dies bedeutet, daß für
die gesamte Abnahme bzw. Einspeisung eines Kunden ein festes, transaktionsunabhängiges
Entgelt für die Netznutzung von seinem Netzanschluß bis zum nächstgelegenen
Höchstspannungsnetz gebildet wird (Netz-Punkt-Tarif). Das Höchstspannungsnetz fungiert
bei diesem Modell als sogenannter Handelspunkt. Alle Lieferungen und Entnahmen können auf
einen derartigen Handelspunkt bezogen werden. Jeder Handelspartner organisiert für sich
den Netzzugang vom Einspeise- bzw. Entnahmeort bis zum Handelspunkt. Der Netz-Punkt-Tarif
beinhaltet demgemäß, daß für jede Entnahme und Einspeisung alle Spannungsebenen von
dem Netzanschluß des Kunden bis einschließlich des Höchstspannungsnetzes als genutzte
Netzebenen anzusehen sind und gezahlt werden müssen. Einspeiser zahlen allerdings wie
bisher keine Netznutzungsentgelte mit Ausnahme des Ersatzes einzelner, ihnen individuell
zuordenbarer Aufwendungen des Netzbetreibers für Netzanschluß und ähnliches.
Mit der neuen Verbändevereinbarung entfällt eine
Möglichkeit der bisherigen Verbändevereinbarung, die einige Vorteile für dezentrale
Erzeugungsanlagen hatte: Bei dezentralen Einspeisungen in niedrige Spannungsebenen konnten
bisher Lieferungen ohne Nutzung des überlagerten Hoch- bzw. Höchstspannnungsnetzes
organisiert und hierdurch erhebliche Einsparungen beim Netznutzungsentgelt erzielt werden.
In der neuen Verbändevereinbarung ist daher die netzentlastende Wirkung dezentraler
Erzeugungsanlagen durch eine sogenannte Netzkostengutschrift
ersetzt worden, die direkt und transaktionsunabhängig vom Netzbetreiber an den
dezentralen Einspeiser gezahlt wird. Die Netzkostengutschrift soll sich an den
Kosteneinsparungen orientieren, die durch die verminderte Leistungsbereitstellung aus dem
überlagerten Netz erzielt werden. Die Netzkostengutschrift für dezentrale
Erzeugungsanlagen soll vom Netzbetreiber auf die allgemeinen Netzkosten umgelegt werden
können.
Die transaktionsbezogene, entfernungsabhängige Komponente
entfällt bei derneuen Verbändevereinbarung. Sie ist tendenziell dadurch ersetzt worden,
daß Deutschland in zwei Handelszonen aufgeteilt wurde. Energielieferungen über die
Grenzen von Handelszonen hinweg werden mit einer Transitkomponente in Höhe von 0,25Pf/kWh
auf den Saldo der ausgetauschten Lieferungen belegt. Die Transitkomponente wird auch an
den Grenzen zum Ausland erhoben.
- Grundlage der Entgeltberechnungen bilden Jahresleistungspreise (DM/kW), also Preise, die
anhand der maximal nachgefragten Leistung des Kunden berechnet werden. Begründet wird das
Erheben eines Jahresleistungs- statt eines Arbeitspreises (DPf/kWh) mit den hohen
Fixkosten des Netzes. Um der Tatsache Rechnung zu tragen, daß sich durch die starke
zeitliche Durchmischung der Kunden im Netz ihre individuellen, zeitungleichen Lastspitzen
ausgleichen, wird das Nutzungsentgelt in einem letzten Schritt durch einen sogenannten
Gleichzeitigkeitsfaktor korrigiert. Gleichzeitigkeitsfaktoren sind Faktoren, mit denen die
individuellen Höchstlasten der Kunden entsprechend ihrem Beitrag zur gesamten
Netzhöchstlast ins Verhältnis gesetzt werden.
Die
Verbändevereinbarung sieht vor, daß die Gleichzeitigkeitsfaktoren
lediglich von der individuellen Benutzungsdauer abhängig sein sollen. Auch kurzfristige,
unterjährige Lieferungen sollen in dieser Weise abgerechnet werden, wenn nicht
individuelle Sonderregelungen getroffen werden. Viele Netzbetreiber rechnen gemäß einer
Empfehlung der VDEW den Jahresleistungspreis - nach unterschiedlichen
Benutzungsdauerstunden im Jahr (h/a) gestaffelt - in eine äquivalente Kombination von
Leistungs- und Arbeitspreisen um. Es ergeben sich meist zwei Benutzungsdauerzonen mit
jeweils unterschiedlichen Leistungs- und Arbeitspreisen. Andere Netzbetreiber bilden dabei
drei Benutzungsdauerzonen.
Einige Netzbetreiber wollen den Gleichzeitigkeitsfaktor
nicht über eine benutzungsdauerabhängige Gleichzeitigkeitskurve, sondern
kundenspezifisch anhand des gemessenen individuellen Lastverlaufs des Kunden im nachhinein
ermitteln. Relevant ist in diesem Fall die tatsächliche Kundenlast zum Zeitpunkt der
allgemeinen Netzhöchstlast des betreffenden Netzbetreibers. Insbesondere für kleinere
Kunden existiert auch die Variante, nach der auf die Leistungsmessung verzichtet wird und
der Entgeltberechnung Normganglinien für bestimmte Kundengruppen zugrundegelegt werden.
Die Entgelte werden dann pauschal als reine Arbeitspreise, gegebenenfalls nach
Kundengruppen wie Haushalt, Gewerbe etc. differenziert, angegeben. Teilweise werden
zusätzlich zu den Arbeitspreisen feste, leistungs- und arbeitsunabhängige Grundpreise
für Kleinkunden verlangt.
Diese Verfahrensweise für die Entgeltgestaltung wird in
der neuen Verbändevereinbarung im wesentlichen beibehalten.
- Neben den leistungsbezogenen Netznutzungsentgelten als
Hauptkomponenten müssen vom Netznutzer noch die sogenannten Systemdienstleistungen,
Meß- und Verrechnungskosten sowie Netzverluste abgegolten werden. Die
Systemdienstleistungen beinhalten die Frequenz-Leistungsregelung im Verbundnetz, die
Betriebsüberwachung der Netze, den Versorgungswiederaufbau bei Netzstörungen und die
Spannungshaltung. Die Frequenz-Leistungsregelung bildet mit ca.70 Prozent den
Hauptkostenblock bei den Systemdienstleistungen.
Die
Messung und Verrechnung des Netzzugangsentgeltes fällt in den Zuständigkeitsbereich des
Netzbetreibers. Hierbei ist zu beachten, daß bei sogenannten Durchleitungskunden wegen
der z.T. komplizierten Abwicklungsvorgänge beim verhandelten Netzzugang ein erheblich
höherer Meßaufwand anfallen kann als bei den vom Netzbetreiber selbst direkt belieferten
Kunden. Die Kosten für die Messung und Verrechnung sind vom Kunden zu tragen.
Der Netznutzer hatte in der alten Verbändevereinbarung das
Wahlrecht, entweder die Netzverluste in natura durch Mehreinspeisung auszugleichen oder
für die Abdeckung der Verluste eine zusätzliche Entgeltkomponente an den Netzbetreiber
zu zahlen. Insgesamt wird die Berechnung der Netzverlustekosten derzeit noch sehr
unterschiedlich gehandhabt: Einige Netzbetreiber haben Entgelte für die Netzverlustkosten
veröffentlicht, die zuzüglich der Briefmarken bezahlt werden müssen. Bei anderen sind
die Entgelte für Netzverluste bereits in der jeweiligen Briefmarke eingerechnet. Die
Möglichkeit des Naturalausgleichs der Verluste durch den Nutzer ist in der neuen
Verbändevereinbarung entfallen. Dies hat hauptsächlich abwicklungstechnische Gründe zur
Folge. Da die Netzverluste für jede genutzte Spannungsebene separat anfallen und
ausgeglichen werden müssen, ist mit dem Naturalausgleich der Verluste ein starker Anstieg
des erforderlichen Datenumfangs für die Abwicklung der Netznutzung verbunden, der
wirtschaftlich nicht vertretbar ist.
- Die alte Verbändevereinbarung sieht als Regelfall vor, daß
der Durchleitungskunde im voraus den Zeitverlauf der von ihm voraussichtlich bezogenen
bzw. eingespeisten Leistung im \1-h-Zeitraster in Form eines sogenannten Fahrplans angeben muß. Die Differenz zwischen diesem Fahrplan
und der tatsächlichen Abnahme bzw. Einspeisung, die sogenannte Fahrplanabweichung, wird
vom Netzbetreiber als Mehr- oder Mindereinspeisung ausgeglichen. Die Kosten für die
Fahrplanabweichungen sind dem Netzbetreiber gesondert zu vergüten. Die
Verbändevereinbarung enthält keinerlei Regelung über die Höhe und die Gestaltung der
Vergütung für den Ausgleich der Fahrplanabweichungen.
In der neuen Verbändevereinbarung ist die Notwendigkeit der Fahrplananmeldung
und -genehmigung weitgehend entfallen. Fahrplananmeldungen sind im Normalfall nur noch
für regelgebietsüberschreitende Lieferungen sowie für größere Kraftwerke (über 100
MW) erforderlich. Als Regelgebiet gemäß neuer
Verbändevereinbarung fungiert jeweils das komplette Netzgebiet eines der acht deutschen
Verbundunternehmen inklusive aller daran angeschlossenen Netze von Verteilnetzbetreibern.
Für Lieferungen innerhalb der Regelgebiete bzw. kleinere Kraftwerke entfällt in der
Regel die Pflicht zur Fahrplananmeldung vollständig. Eine Fahrplangenehmigung ist für
Lieferungen nur noch dann erforderlich, wenn vom zuständigen Netzbetreiber regelmäßige
Netzengpässe vorab öffentlich bekanntgemacht worden sind.
Die Regelungen zu Fahrplanabweichungen wurden in der neuen
Verbändevereinbarung durch die Einführung sogenannter Bilanzkreise
ersetzt, mit denen auf Händlerebene alle tatsächlichen Einspeisungen und Entnahmen
innerhalb eines Regelgebietes saldiert werden können. Fahrplanabweichungen, die nach der
alten Verbändevereinbarung für jede einzelne Transaktion ermittelt und abgerechnet
wurden, werden in der neuen Verbändevereinbarung nur noch in Ausnahmefällen betrachtet.
Der Händler faßt im Rahmen eines Bilanzkreises alle seine
Geschäfte innerhalb eines Regelgebietes zusammen. Unter Bilanzabweichung
eines Händlers versteht man die Differenz zwischen der Summe aller tatsächlichen
Einspeisungen und der Summe aller tatsächlichen Abnahmen der Kunden des Händlers im
jeweiligen Regelgebiet bezogen auf die Meßperiode (zur Zeit 1/4-Stunde). Für Lieferungen
zwischen verschiedenen Regelgebieten werden anstelle gemessener Werte allerdings noch
angemeldete Fahrpläne verwendet. Der Händler kann also im Rahmen eines Bilanzkreises das
Abnahme- und Einspeiseverhalten aller seiner Kunden zusammenfassen und aggregieren, der
Einzelkunde wird nicht mehr isoliert betrachtet.
Der Übertragungsnetzbetreiber ist für den physikalischen
Ausgleich der Bilanzabweichungen verantwortlich. Die Kosten hierfür rechnet der Händler
mit dem Übertragungsnetzbetreiber ab. Bilanzabweichungen können teilweise durch
Naturalausgleich, d.h. durch Mehr- oder Minderlieferungen zu späteren Zeitpunkten,
verrechnet werden. Geringe Bilanzabweichungen bis zu 5 Prozent, in Ausnahmefällen auch
bis zu 20 Prozent, der Gesamtlast eines Bilanzkreises werden mit reinen Arbeitspreisen
oder per Naturalausgleich verrechnet, höhere Abweichungen werden mittels Leistungspreisen
pönalisiert.
Quelle: Deutscher Wirtschaftsdienst 01/2000
Seitenanfang
Stichwort Braunkohleschutzklausel:
Leipzig (dpa) - Bis 2003 gilt im Osten auf
Grund der Milliarden-Investitionen zur Modernisierung der Kraftwerke die so genannte
Braunkohleschutzklausel. Mit ihrer Hilfe können sich die Versorger weigern, Fremdstrom
durchzuleiten, wenn dadurch die Braunkohleverstromung gefährdet wird. Dennoch geht der
Wettbewerb am Osten nicht vorbei und zwingt die Anbieter zu Preisnachlässen. Nach dem
Energiewirtschaftsgesetz kann die Klausel bis 2005 verlängert werden. In der
Ost-Braunkohle sind nach einem Verlust von mehr als 100 000 Stellen seit der Wende noch
etwa 20 000 Kumpel tätig.
Ende Oktober hatten die Aktionäre des
Braunkohleverstromers Vereinigte Energiewerke AG (VEAG/Berlin) Bundeswirtschaftsminister
Werner Müller (parteilos) ein «Stabilisierungsmodell»
präsentiert. Nach dem Modell wollen die Gesellschafter den von der VEAG erzeugten
Braunkohlestrom zu kostenorientierten Preisen vollständig abnehmen und die
Kostendifferenz zum niedrigeren Marktpreis selbst tragen. Dieses Stabilisierungsprogramm
soll bereits zum 1. Januar 2000 greifen. Ein neuer Privatisierungsvertrag der
Treuhandnachfolgerin BvS mit den VEAG-Gesellschaftern wird dazu auch angestrebt.
Müller will den West-Stromkonzernen bei
ihrer Offerte entgegenkommen. Er ist bereit, den westdeutschen Veag-Eigentümern den bis
2013 fälligen zweiten Teil des Kaufpreises in Milliardenhöhe gegen Arbeitsplatzsicherung
zu erlassen. Im Gegenzug sollen sich die VEAG-Eigentümer verpflichten, das ostdeutsche
Energieunternehmen mit seinen derzeit rund 7 000 Arbeitsplätzen langfristig zu erhalten.
Die VEAG hatte in diesem Zusammenhang die
Öffnung ihres Netzes für Fremdstrom angekündigt. Sollte der neue Vertrag zu Stande
kommen, will sie den Strom ihrer Wettbewerber ab Januar durchleiten. Die bis 2003 geltende
Braunkohleschutzklausel wäre dann praktisch gegenstandslos. Die Veag gehört mehrheitlich
dem Bayernwerk, RWE und PreussenElektra. Weitere Eigner sind EnBW, VEW, Bewag und HEW.
Quelle: dpa 16/11/’99
Seitenanfang
Strom-Monopoly im Neufünfland
West-EVU kassieren von Ost-Stromkunden Milliarden von Mark
zuviel: Geld zurückfordern!
In den neuen Ländern ist ein Konflikt zwischen Stadtwerken
und den Regional- und Verbundunternehmen aufgebrochen, der für die Verbraucher höchst
interessant zu werden verspricht.
Denn die Stadtwerke-Ost haben gemeinsam ein Gutachten über
das Ost-Verbund-EVU VEAG (Vereinigte Energiewerke Aktiengesellschaft) erstellen lassen:
Von der LBD BeratungsgesellschaftmbH, Berlin. Das Ergebnis ist sensationell. Denn es
belegt im Detail einen Preismißbrauch des Stromkartells in den neuen Ländern.
Als ”ewige Gelddruckerlaubnis” hatte die
Energiedepesche im Heft 10, 1990 den Stromvertrag kritisiert. Das vorliegende Gutachten
zeigt im Detail auf, daß mit diesen Verträgen inzwischen Milliarden gemacht worden sind,
daß dies zu Lasten der Verbraucher ging und trotz ausgeklügelter Verträge gegen
geltendes Recht verstößt.
Die VEAG hält dagegen, sie habe kaum Gewinn gemacht, keine
Dividenden ausgeschüttet und sei durch die Braunkohleverstromung schwer belastet. Daher
gebe es keine Spielräume für Preissenkungen.
Das Gutachten zeigt jedoch, daß die VEAG zwischen 1991 und
1994 tatsächlich einen Gewinn von 4,4 Milliarden Mark erzielt hat. Diesen Gewinn hat sie
in den Bilanzen säuberlich versteckt. Der operative Cash-Flow (Einnahmen abzüglich
Ausgaben abzüglich Abschreibungen) betrug sogar 7,5 Milliarden Mark. Die VEAG konnte
aufgrund der überhöhten Strompreise ihr Eigenkapital von 800 Millionen auf 5,5
Milliarden DM aufbessern. Um diesen Betrag sind dem Gutachten zufolge die Anteilseigener
der VEAG, in der Hauptsache RWE, Preussenelektra und Bayernwerk auf Kosten der Stromkunden
Ost reicher geworden. Dies trotz angeblich belastender Umweltauflagen, Soziallasten,
Investitions- und Sanierungslasten, Braunkohleverstromungs-”Verpflichtungen”
sowie Konkurrenz zur Eigenstromerzeugung. Durch die bilanztechnische Verdeckung der
Gewinne brauchte die VEAG auch kaum Ertragssteuern zu zahlen, die bei offener Ausweisung
der Gewinne in Milliardenhöhe fällig gewesen wären. Die VEAG konnte auch in großem
Umfang liquide Mittel ansammeln, so daß 1994 allein 245 Millionen DM an Zinsgewinnen
erzielt wurden.
Das Gutachten hat die VEAG mit strukturähnlichen
Verbundunternehmen West verglichen. Diese Unternehmen haben 65% ihres operativen
Cash-flows (Einnahmen abzüglich Ausgaben abzüglich Abschreibungen) als Gewinn
ausgewiesen. Die VEAG weist trotz deutlich höherem Cash-flow in ihren Bilanzen einen
Verlust aus. Im Vergleich zu anderen Stromversorgern und Unternehmen anderer Branchen
liegen die Kapitalrenditen der VEAG weit über dem Durchschnitt.
Das Gutachten folgert: ”Die VEAG
betreibt für sich und ihre Anteilseigner eine exzessive Konsolidierungs- und
Thesaurierungspolitik zu Lasten der ostdeutschen Stromverbraucher. Die VEAG versucht, ihre
marktbeherrschende Stellung als Stromerzeuger in den neuen Bundesländern mit allen
Mitteln aufrechtzuerhalten und auszubauen, ohne einen Beitrag zu einer preiswürdigen und
ressourcenschonenden Stromversorgung für die ostdeutschen Stromverbraucher zu leisten.
Das Kartellgesetz gibt auch den von wettbewerbsbeschränkenden und mißbräuchlichen
Verhaltensweisen betroffenen Unternehmen direkte, vor den Zivilgerichten geltend zu
machende Schadensersatzansprüche.”
Die Gründung der VEAG
Am 22.08.1990 hat die damalige DDR-Regierung mit der
Treuhandanstalt und RWE, Preussenelektra und Bayernwerk den
”Stromvertrag-Verbundstufe” und den ”Stromvertrag-Regionalstufe”
abgeschlossen. Die beiden früheren Verbund-Unternehmen der DDR mit ihren Kraftwerken
wurden zur VEAG AG verschmolzen. Diese neue VEAG ging zu drei Vierteln an die drei
West-EVU. Gleichzeitig gingen sieben der elf Regional-EVU der DDR zu 51% an dieselben drei
West-EVU. Die noch nicht bedienten westdeutschen Verbund-Unternehmen (BEWAG, HEW, EVS,
VEW, IAW) erhielten die vier restlichen Regional-EVU sowie 25%-Anteil an der VEAG. Die
Regional-EVU wurden verpflichtet, 70% ihres Strombedarfs von der VEAG zu beziehen. Als
Kaufpreis für die VEAG waren vier Milliarden Mark zu zahlen, davon zwei Milliarden
sofort. Ferner verpflichteten sich die VEAG-Käufer dazu, eine sichere und preisgünstige
Versorgung anzustreben, die dem westdeutschen Preisniveau vergleichbar ist und die
gegenwärtig herausragende Rolle der Braunkohleverstromung zu beachten (Präambel
Stromvertrag).
Zunächst übernahmen die West-EVU nur die
Geschäftsbesorgung der VEAG, die Privatisierung erfolgte erst am 6.9.1994. In der
Zwischenzeit hatte die VEAG schon Milliardenpolster gebildet. Kurz vor der Privatisierung
wurde von der Treuhand im Juni 1994 ein Vermögen von 3,1 Milliarden Mark von der VEAG als
eigenständiges Unternehmen (”VEAG-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH”) im
Treuhand-Bereich abgespalten. Um den Wert dieser Abspaltung wurde der VEAG-Kaufpreis
reduziert. Die VEAG wurde also nach diesen in der Studie enthaltenen Informationen
praktisch verschenkt. Es fragt sich hier, ob der Staat in Person der Treuhand Milliarden
an die Privatwirtschaft verschenken darf.
Die Abspaltung hat den Charakter einer verdeckten
Gewinnausschüttung: Denn das Vermögen der VEAG wurde ohne steuerrechtlich zulässige
Gründe gemindert. ”Damit verstieß die Treuhandanstalt gegen § 42 der
Abgabenordnung”.
Bilanzakrobatik der VEAG
Abschreibungen sollen die Anschaffungs- und
Herstellungskosten abnutzbarer Vermögensgegenstände über deren Lebensdauer verteilen.
Derartige Abschreibungen sind Kosten der Stromherstellung und gehen als solche in die
Strompreiskalkulation ein. Sie sichern die Erhaltung der Vermögenssubstanz des
Versorgungsunternehmens.
Die VEAG hat aber eine Reihe von überhöhten
Abschreibungen vorgenommen, denen kein Werteverzehr gegenübersteht. Durch solche
Abschreibungen bereichert sich ein Stromversorger auf Kosten seiner Stromkunden.
Gleichzeitig werden überhöhte Einnahmen verschleiert.
Die VEAG hat in ihrer Eröffnungsbilanz zum 1. Juli 1990
für den Kraftwerkspark 4,19 Mrd. DM in Ansatz gebracht. Nach sorgsamer Berechnung wäre
hierfür lediglich ein Betrag von 1,51 Mrd. DM angemessen gewesen. Auf diesen überhöhten
Wert sind dann Abschreibungen vorgenommen worden, ”die letztlich vom Stromverbraucher
über den Strompreis gezahlt worden sind. Hier hat die VEAG entgegen ihrer Verpflichtung,
eine preiswürdige Versorgung durchzuführen, gehandelt und die auf den zu hohen
Wertansätzen beruhenden Abschreibungsbeiträge einbehalten”.
Die VEAG hat dann ”die ursprünglich schon zu hohe
Anlagenbewertung der DM-Eröffnungsbilanz später noch einmal um 2,95 Mrd. DM erhöht und
damit für 1993 und 1994 weitere zusätzliche Abschreibungsspielräume von mehr als 1,5
Mrd. DM geschaffen und auch genutzt. Auch diese weiteren Abschreibungen waren nur
möglich, weil die VEAG über zu hohe Strompreise Einnahmen aus dem Stromverkauf erzielte,
die sie entweder zu Preissenkungen oder zur Versteuerung eines Gewinns hätte veranlassen
müssen. Da dies nicht geschah, verblieben die vom Stromverbraucher gezahlten Beträge im
Unternehmen und gehören als Substanz nunmehr den Anteilseignern”. Dies ist
erstaunlich, weil ein Großteil der zu bewertenden Anlagen nach VEAG-Angaben völlig
veraltet, umweltschädlich und unproduktiv war. Alle diese Anlagen sollten mit erheblichem
Aufwand abgerissen oder grundlegend modernisiert werden.
' Zwischen 1991 und 1994 hat die VEAG zusätzlich
Sonderabschreibungen nach §4 Fördergebietsgesetz in Höhe von 1,9 Mrd. DM vorgenommen.
Auch diesen Sonderabschreibungen steht kein Werteverzehr gegenüber. ”Sie dienen
nicht einer preiswürdigen Versorgung der Verbraucher, sondern allein den Interessen der
VEAG und ihrer Anteilseigner, denen auf diese Weise Vermögen zuwächst”.
”Wir haben nachgewiesen”, so das Gutachten,
”daß die VEAG erhebliche Überschüsse erzielt hat, die unter Abspaltung und durch
Sonderabschreibungen bilanztechnisch für den gegebenenfalls sonst auszweisenden Gewinn
unsichtbar gemacht worden sind. Die Höhe dieser Summe, bezogen auf den Zeitraum von
1991-1994 sind rund 6,6 Mrd. DM über den vom Stromverbraucher gezahlten Strompreis für
Abspaltung und Sonderabschreibungen verwendet worden, läßt nur den Schluß einer nicht
kostengerechten Preiskalkulation zu” (Gutachten, S. 190).
Die VEAG hat auf dem Rücken der Stromverbraucher aus
Gewinnen beim Stromverkauf ein Eigenkapital von rd. 4,2 Mrd. DM aufgebaut. Auch diese
Vermögenspolitik verstößt gegen das Kartellgesetz §103 Abs. 5. Atz 1 Nr. 1.
Die 70:30-Regelung
Die VEAG versorgt selbst so gut wie keine Endverbraucher,
sondern erzeugt in ihren Kraftwerken fast den gesamten Strom und verteilt ihn über ihr
Verbundnetz überregional an die elf Regional-EVU in den neuen Ländern. Diese verkaufen
ihrerseits den Strom an Letztabnehmer und Stadtwerke.
Das überhöhte Preisniveau der VEAG ist nur durchzuhalten
durch die ”70:30-Regelung”. Diese Regelung verpflichtet die Regional-EVU, 70%
ihres Strombedarfs durch Bezug von der VEAG abzudecken. Dadurch müssen die Regional-EVU
an die VEAG jeden geforderten Preis zahlen. Sie werden dies aber gern tun. Denn die
Regional-EVU gehören zu 51% denselben West-EVU, denen auch die VEAG selbst gehört.
Darüber hinaus sind in den Aufsichtsräten aller Regional-EVU Vorstände der drei
West-EVU vertreten. Ebenso sind die Vorstände mit Persönlichkeiten der westdeutschen
Verbundwirtschaft besetzt.
Die 70:30-Regelung ist ein nach §1 Kartellgesetz
verbotenes und damit rechtlich unwirksames Kartell. Das entsprechende Kapitel des
Gutachtens stammt von Prof. Siegfried Klaue, dem früheren Leiter der einschlägigen
Beschlußabteilung des Bundeskartellamts.
Die Regional-EVU haben die 70:30-Regelung auch gegenüber
den durch sie belieferten Stadtwerken als Bedingung für die Herausgabe der Stromnetze
durchgedrückt.
Bezüge im 30%-Segment sind besonders interessant. Denn sie
erfolgen freiwillig und stehen damit in direkter Konkurrenz zur Eigenerzeugung. Im
30%-Segment werden die Preise künstlich niedrig gehalten, um die Stromeigenerzeugung
unwirtschaftlich zu machen. Auch dies ist lt. Prof. Klaue mißbräuchlich nach
Kartellgesetz.
Am 31.01.1996 hat die VEAG in Erfurt anläßlich eines
”Energie-Konsens-Gesprächs-Ost” im 30%-Segment einen Preisnachlaß von 150 Mio.
DM verkündetet. Vorausgegangen war politischer Druck auf die VEAG-Preise. Dieser Nachlaß
stellt als sog. ”Treuerabatt” eine unbillige Behinderung durch ein
marktbeherrschendes Unternehmen dar im Sinne von GWB §26 Nr. 2. Daran ändert auch
nichts, daß diese Maßnahme auf einer Wirtschaftsministerkonferenz bekanntgegeben und von
den Wirtschaftsministern mindestens stillschweigend entgegegenommen worden ist.
Die ”Braunkohlen-Lüge”
Die VEAG rechtfertigt ihre überhöhten Preise mit den für
die Verstromung der Braunkohle eingegangenen Verpflichtungen. Tatsächlich erzeugt die
VEAG derzeit ihren Strom zu über 90% aus Braunkohle. In der Vergangenheit hat der hohe
Braunkohleeinsatz die VEAG-Strompreise kaum belastet: ”Bei Brennstoffkosten von knapp
3 Pf/kWh sowie durchschnittlichen Stromerlösen von über 20 Pf /kWh kann die Begründung
für unterschiedliche Preise u. E. nicht im Einsatz der Braunkohle zur Stromerzeugung
gesucht werden. Hinzu kommt, daß zur Zeit bei dem Einsatz von Altkraftwerksleistung in
noch erheblichem Umfang ein vergleichsweise teurer Kapitaldienst wie für Neuanlagen nicht
anfällt” schreibt der Deutsche Braunkohlenverein e.V. (Wirtschaftswelt Energie
12/95, S. 23).
Für die Zukunft strebt die VEAG aber eine Beibehaltung des
hohen Braunkohleanteils an. Braunkohle eignet sich aber aus wirtschaftlichen Gründen nur
für den Einsatz in der sog. Grundlast, die nur 50% der Leistung ausmachen sollte. 30% der
Leistung sollten Mittellastkraftwerke darstellen, typischerweise Steinkohle. Die letzten
20% sollen auf Spitzenlastkraftwerke entfallen (i.d.R. Gasturbinen).
Durch den überzogenen Braunkohleanteil allein erhöht sich
künftig der Strompreis um ca. 1 bis 1,5 Pf/kWh. Dieses Konzept verstößt damit gegen den
Grundsatz einer preiswürdigen Energieversorgung. Soweit die VEAG tatsächlich zur
Sicherung der Braunkohle verpflichtet wäre, so würde der überhöhte Strompreis eine
Sonderabgabe darstellen. Nach dem Kohlepfennigbeschluß des Bundesverfassungsgerichts ist
eine solche Sonderabgabe verfassungswidrig. Im übrigen wären auch die Bürger der alten
Bundesländer für eine solche Aufgabe mitheranzuziehen. Weiterhin würde eine solche
Sonderabgabe auch gegen die Beihilfevorschriften des europäischen Rechts verstoßen.
Das braunkohlefixierte Unternehmenskonzept der VEAG ist
willkürlich und schadet dem Verbraucher, weil er höhere Strompreise zu zahlen hat, als
er bei einem an der energierechtlichen Rahmenordnung gemessenen Verhalten bezahlen
müßte. ”Es ist nicht Aufgabe der privatisierten VEAG, Gemeinwohlaufgaben zu
erfüllen und die dadurch entstehenden Kosten auf ihre Strombezieher abzuwälzen...Die
angeblich bindende Zielvorgabe für eine spezifische Braunkohlepolitik existiert nicht und
ist deshalb für die von der VEAG ausgeübte Braunkohlepolitik keine brauchbare
Rechtfertigung... Von einer Verstromung der Braunkohle in der Mittellast, verbunden mit
einer Weisung an die VEAG, das Postulat einer preiswürdigen Versorgung zu verletzen, ist
im Stromvertrag nichts zu finden. Die in der Diskussion um die Ostdeutschen Strompreise
ständig leicht dahingesprochene These von der Abhängigkeit der VEAG von der Braunkohle
als strukturell hinzunehmendem Verteuerungsfaktor, erweist sich damit als nicht
stichhaltig. Sie findet weder im Stromvertrag, noch in der Sache eine Rechtfertigung”
(Gutachten, S. 179).
Strompreise West-Ost
Das Strompreisgenehmigungsverfahren billigt den
Stromversorgungsunternehmen angemessene Gewinne zu. Das in Nordrhein-Westfalen eingesetzte
Erhebungsbogenverfahren wurde im Gutachten auf die VEAG angewendet. Es stellt sich heraus,
daß die VEAG nach korrekter Bilanzierung ”Fünf Mrd. DM mehr Gewinn erzielt hätte,
als nach dem Erhebungsbogenverfahren genehmigungsfähig wäre” (S. 83). ”Das
Ergebnis zeigt, daß die VEAG erheblich höhere Gewinne erzielt, als sie nach einer
vereinfachten Gewinnermittlung gemäß Erhebungsbogenverfahren zur Genehmigung von Tarifen
genehmigungsfähig wären” (S. 84). ”Für 1994 ergibt sich ein angemessener
Gewinn in Höhe von 611 Mio. DM. Die VEAG hatte aber einen Vorsteuergewinn von 1.735 Mio.
DM erreicht. Der Gewinn der VEAG übersteigt den höchsten angemessenen Gewinn um 1.124
Mio. DM in 1994. Der Teil des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, der den
angemessenen Gewinn übersteigt, ist eine Monopolgewinn und von der VEAG den Kunden für
die Vergangenheit zurückzugewähren. Für die Vergangenheit bedeutet dies einen
Rückzahlungsanspruch der Kunden gegenüber der VEAG in Höhe von rund 2.640 Mio. DM und
bezogen auf das Geschäftsjahr 1994 eine Preissenkungserfordernis von 2,24 Pf/kWh”(S.
90). ”Für das Jahr 1996 ergibt sich gegenüber 1994 eine Preissenkungserfordernis
von 1.058 Mio. DM oder 2,1 Pf/kWh. Dies würde zu einem spezifischen Strompreis der VEAG
von ca. 10,5 Pf/kWh führen”(Gutachten, S. 97).
Beim Vergleich der Strompreise zwischen alten und neuen
Bundesländern ergibt sich eindeutig ein Preisgefälle zugunsten der alten Länder.
Schadensersatzansprüche
”Zivilrechtlich ist der Grundsatz der preiswürdigen
Energieerzeugung über § 134 BGB in Verbindung mit § 315 BGB durchzusetzen. Daraus
ergibt sich:
Preise, die in der Vergangenheit zu hoch waren, müssen
rückwirkend (soweit weder Verwirkung noch Verjährung eingetreten ist) korrigiert werden.
Aus der Sicht der Endverbraucher liegt der Schaden auf der Hand. Sie hätten bei
angemessenem Strompreis in der Vergangenheit mehr im Portomonnaie behalten.
Für die Zukunft sind auf allen Marktstufen die Preise auf
der Grundlage des vom BGH entwickelten Preisbestimmungskonzeptes zu kontrollieren und
jeweils auf die angemessen Höhe zu bringen” (Gutachten, S. 223).
”Marktverhalten der VEAG”
Ein dreibändiges Gutachten bringt es an den Tag: Die
großen West-EVU haben als Besitzer des Ost-Verbund-EVU VEAG den Stromkunden-Ost mehrere
Milliarden Mark zuviel abverlangt und damit gegen geltendes Recht verstoßen. Die
betroffenen Kunden, insbesondere Firmen sollten sich ihr Geld von der VEAG zurückholen.
Wer als Firmenverantwortlicher auf diesen Rückzahlungsanspruch verzichtet, der verschenkt
das Geld seiner Firma und haftet dafür mit seinem Privatvermögen. Die VEAG bestreitet
die Vorwürfe.
Man darf auf den Ausgang dieser Auseinandersetzung gespannt sein.
Was ist zu tun?
Tarifkunden haben wenig Chancen auf Rückerstattung
überhöhter Preise: Die Beträge sind gering und die Tarifgenehmigung schützt die EVU.
Anders bei Sondervertragskunden: Hier gibt es keine genehmigten Tarife und es geht um
höhere Summen, um die sich ein Streit lohnt. Auch wenn der Strom nicht direkt von der
VEAG bezogen wird: Der Anspruch, so das Gutachten, besteht auch gegenüber einem
Regionalversorger oder Stadtwerk, das seinerseits den Strom zu teuer von der VEAG bezogen
hat. Der Bund der Energieverbraucher sammelt und vermittelt Adressen von Kunden, die eine
gerichtliche Auseinandersetzung anstreben.
Tip
Zahlen Sie Ihre Stromrechnung unter Vorbehalt, um später
die Rückerstattungsansprüche nicht zu verlieren oder verjähren zu lassen. Einige
Stadtwerke werden gegen die VEAG klagen. Je nach Ausgang sind dann Anschlußklagen relativ
erfolgversprechend.
Das LBD-Gutachten kann zumPreis von 200 DM bezogen
werden bei:
Becker, Büttner & Partner
Fax: 030 / 611284099.
Gutachten der WIBERA zu den Strompreisen und den
Lieferverträgen der Regionalversorgungsunternehmen (RVU) in den neuen Ländern.
Bei Abschluß der Strombezugsverträge mit den RVU waren
die Stadtwerke in einer ungünstigen Position. Nach dem Stromvergleich hatten die Kommunen
zwar einen Anspruch auf die örtlichen Anlagen und Netze; die Übertragung koppelten die
RVU jedoch in der Regel an den Abschluß ihnen genehmer, für die Stadtwerke aber
ungünstiger Bezugsverträge.
Das Gutachten der Wibera stellt eine erste systematische
Untersuchung der Bezugspreise und Lieferverträge der Stadtwerke dar. Wesentliches
Ergebnis ist, daß die Preise der RVU überhöht und die Verträge einseitig zum Nachteil
der Stadtwerke konzipiert sind.
Obwohl alle 12 RVU ihren Strom nach einem Einheitsvertrag
beziehen, sind die Bezugspreise sowie die Bezugskonditionen für die Stadtwerke höchst
unterschiedlich. Die Preisunterschiede machen bis zu 15% aus. In der Regel sind sie
deutlich ungünstiger als in Westdeutschland. Dies nährt den Verdacht, daß die Preise
nicht, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, ”kostenverursachungsgerecht”
gestaltet sind. Durchschnittlich zahlen die ostdeutschen Stadtwerke um 2,5 Pf/kWh höhere
Preise als in Westdeutschland. Hinzu kommt, daß die VEAG den RVU Preisnachlässe gewährt
hat, die bislang nicht an die Stadtwerke weitergegeben wurden.
Trotz günstigerer Bezugspreise haben die RVU - mit
Genehmigung der Preisbehörden - die Tarife erhöht. Stadtwerke wurden entsprechende
Tariferhöhungen nicht genehmigt. Das bedeutet, daß die Preise der Stadtwerke für
Haushalte sich im Schnitt deutlich unterhalb denen der RVU bewegen. Gravierend ist
außerdem, daß drei östliche RVU von den Stadtwerken höhere Preise als von
letztverbrauchenden Industriekunden verlangen - bei gleichen Abnahmeverhältnissen. Das
hat zur Konsequenz, daß diese Stadtwerke große Industriekunden nicht oder nur mit
Verlusten beliefern können.
Auch von der Kostenseite her werden die RVU-Preise unter
die Lupe genommen. Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, daß die meisten RVU die aus den
Kosten errechneten Preisobergrenzen unangemessen überschreiten. Berücksichtige man
allein die zwischenzeitlich von der VEAG den RVU gewährten Preisnachlässe, sei ein
Preissenkungsspielraum bis zu 1,1 Pf/kWh ab 1994 evident.
Die Analyse der Lieferverträge ergibt, so die Wibera,
vielfältige Benachteiligungen ostdeutscher Stadtwerke gegenüber westdeutschen. Im Kern
würden alle Risiken, die mit dem Bezug von elektrischer Leistung verbunden seien, auf die
Stadtwerke verlagert - bei überhöhten Preisen. Auch hätten die RVU extrem lange
Laufzeiten durchgesetzt ohne ausreichende Möglichkeiten für Vertragsanpassungen.
Kritisiert werden auch die Verträge über
Reservelieferungen. Die von den RVU angebotenen Konditionen seien sehr unterschiedlich.
Ein Vergleich deute auch hier auf überteuerte Angebote einiger RVU hin.
Quelle: Bund der Energieverbraucher e.V., Rheinstr. 8,
53619 Rheinbreitbach
Seitenanfang
Gesetz zur Neuregelung des
Energiewirtschaftsrechts
Der Bundestag hat das folgende Gesetz
beschlossen:
Art.1 - Gesetz über die Elektrizitäts- und
Gasversorgung
Energiewirtschaftsgesetz - EnWG
vom 29. 4. 1998 (BGBl. I S. 730)
§ 1 - Zweck des Gesetzes
Zweck des Gesetzes ist eine möglichst
sichere, preisgünstige und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung mit
Elektrizität und Gas im Interesse der Allgemeinheit.
§ 2 - Begriffsbestimmungen
(1) Energie sind Elektrizität und Gas, soweit sie zur
leitungsgebundenen Energieversorgung verwendet werden.
(2) Energieanlagen sind Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung
oder Abgabe von Energie, soweit sie nicht lediglich der Übertragung von Signalen dienen.
(3) Energieversorgungsunternehmen sind alle Unternehmen und
Betriebe, die andere mit Energie versorgen oder ein Netz für die allgemeine Versorgung
betreiben.
(4) Umweltverträglichkeit bedeutet, daß die
Energieversorgung den Erfordernissen eines rationellen und sparsamen Umgangs mit Energie
genügt, eine schonende und dauerhafte Nutzung von Ressourcen gewährleistet ist und die
Umwelt möglichst wenig belastet wird. Der Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung und
erneuerbaren Energien kommt dabei besondere Bedeutung zu.
(5) Die Abnahme- und Vergütungspflicht für die
Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien in das Netz für die allgemeine
Versorgung richtet sich nach dem Stromeinspeisungsgesetz.
§ 3 - Genehmigung der
Energieversorung
(1) Die Aufnahme der Energieversorgung anderer bedarf der
Genehmigung durch die Behörde. Die Genehmigungspflicht unterliegen nicht
1. die Einspeisung in das Netz eines
Energieversorgungsunternehmens;
2. die Versorgung von Abnehmern außerhalb der allgemeinen
Versorgung im Sinne des § 10 Abs. 1, sofern die Belieferung überwiegend aus Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energien, aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder aus Anlagen erfolgt,
die Industrieunternehmen zur Deckung des Eigenbedarfs betreiben sowie
3. die Versorgung verbundener Unternehmen im Sinne des §
15 des Aktiengesetzes.
(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn
1. der Antragsteller nicht die personelle, technische und
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit besitzt, um die vorgesehene Energieversorgung
entsprechend den Zielen und Vorschriften dieses Gesetzes auf Dauer zu gewährleisten, oder
2. bei Aufnahme der Elektrizitätsversorgung die beantragte
Versorgungstätigkeit zu ungünstigeren Versorgungsbedingungen für die betroffenen
Abnehmer insgesamt führen würde oder sich für das verbleibende Gebiet des bisherigen
Versorgers erhebliche Nachteile ergeben würden; dabei ist das Ziel einer möglichst
sicheren, preisgünstigen und umweltverträglichen Energieversorgung angemessen zu
berücksichtigen.
§ 4 - Betrieb des
Elektrizitätsversorgungsnetzes
(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind zu einem
Betrieb ihres Versorgungsnetzes verpflichtet, der eine Versorgung entsprechend den Zielen
des § 1 sicherstellt.
(2) Die Betreiber des Übertragungsnetzes für
Elektrizität sind verpflichtet, technische Mindestanforderungen für den Anschluß an
dieses Netz festzulegen und zu veröffentlichen. Die Anforderungen sind der Behörde sowie
der Europäischen Kommission mitzuteilen.
(3) Die Betreiber des Übertragungsnetzes für
Elektrizität sind verpflichtet, objektive Kriterien für die Einspeisung aus
Erzeugungsanlagen und die Benutzung von Verbindungsleitungen festzulegen und
diskriminierungsfrei anzuwenden. Die Kriterien sind zu veröffentlichen.
(4) Das Übertragungsnetz ist als eigene
Betriebsabteilung, getrennt von Erzeugung und Verteilung sowie von den übrigen
Tätigkeiten, die nicht mit ihm zusammenhängen, zu führen.
§ 5 - Zugang zum
Elektrizitätsversorgungsnetz
Der Zugang zum Elektrizitätsversorgungsnetz
erfolgt, vorbehaltlich des § 7, nach dem System des verhandelten Netzzugangs.
§ 6 -Verhandelter Netzzugang
(1) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen haben
anderen Unternehmen das Versorgungsnetz für Durchleitungen zu Bedingungen zur Verfügung
zu stellen, die nicht ungünstiger sind, als sie von ihnen in vergleichbaren Fällen für
Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten
Unternehmen, tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden. Dies gilt
nicht, soweit der Betreiber nachweist, daß ihm die Durchleitung aus betriebsbedingten
oder sonstigen Gründen unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 nicht möglich oder
nicht zumutbar ist. Die Ablehnung ist schriftlich zu begründen. § 22 Abs. 4 und § 26
Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen bleiben unberührt.
(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann, soweit dies
zur Erreichung der Ziele des § 1 und zur Gewährleistung wirksamen Wettbewerbs
erforderlich ist, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Gestaltung der
Verträge nach Absatz 1 regeln und Kriterien zur Bestimmung von Durchleitungsentgelten
festlegen.
(3) Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit nach Absatz 1 Satz
2 ist besonders zu berücksichtigen, inwieweit dadurch Elektrizität aus
fernwärmeorientierten, umwelt- und ressourcenschonenden sowie technisch-wirtschaftlich
sinnvollen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder aus Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien verdrängt und ein wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen verhindert würde,
wobei Möglichkeiten zum Verkauf dieser Elektrizität an Dritte zu nutzen sind.
(4) Die Betreiber des
Elektrizitätsversorgungsnetzes veröffentlichen jährlich, erstmals im Jahr 2000,
Richtwerte zur Spanne der Durchleitungsentgelte. In den folgenden Jahren sollen die
Angaben auf dem Durchschnitt der in den vergangenen zwölf Monaten ausgehandelten Entgelte
beruhen.
§ 7 - Netzzugangsalternative
(1) Die Behörde erteilt
Elektrizitätsversorgungsunternehmen für die Versorgung von Letztverbrauchern eine
Bewilligung, durch die die Anwendung des § 5 ausgeschlossen wird. Die Bewilligung setzt
voraus, daß der Netzzugang nach den Absätzen 2 bis 5 erfolgt und zu erwarten ist, daß
dieser Netzzugang zu gleichwertigen wirtschaftlichen Ergebnissen und daher zu einer direkt
vergleichbaren Marktöffnung sowie einem direkt vergleichbaren Zugang zu den
Elektrizitätsmärkten führt. Die Bewilligung darf nur einheitlich für das gesamte
Gebiet, in dem das Elektrizitätsversorgungsunternehmen die allgemeine Versorgung
durchführt, oder für alle von ihm versorgten Gebiete einer Gemeinde erteilt werden.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 ist das
Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die Elektrizität abzunehmen, die ein
Letztverbraucher, der im Gebiet, auf das sich die Bewilligung nach Absatz 1 bezieht,
ansässig ist, bei einem anderen Elektrizitätsversorgungsunternehmen gekauft hat. § 6
Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.
(3) Die Vergütung für nach Absatz 2 abzunehmende
Elektrizität muß mindestens dem vom Letztverbraucher an das versorgende
Elektrizitätsversorgungsunternehmen zu zahlenden Preis, vermindert um den Tarif für die
Nutzung des Versorgungsnetzes, entsprechen. § 6 Abs. 1 Satz 1 gilt dabei entsprechend.
Dieser Tarif bedarf der Genehmigung durch die Behörde und ist durch das
Elektrizitätsversorgungsunternehmen öffentlich bekanntzumachen.
(4) Die Tätigkeiten des
Elektrizitätsversorgungsunternehmens nach den Absätzen 2 und 3 sind getrennt von der
Erzeugungs- und Verteilungstätigkeit zu verwalten. Es dürfen keine Informationen
zwischen den Tätigkeiten nach den Absätzen 2 und 3 und den Erzeugungs- und
Verteilungsaktivitäten vermittelt werden, es sei denn, daß diese Informationen für die
Erfüllung der Aufgaben nach den Absätzen 2 und 3 erforderlich sind.
(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft
kann, soweit dies zur Erreichung der Ziele des § 1 und zur Gewährleistung wirksamen
Wettbewerbs erforderlich ist, materiellrechtliche Einzelheiten zu den in den Absätzen 1
bis 4 getroffenen Regelungen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
festlegen.
§ 8 - Überprüfung der
Netzzugangsregelung
Das Bundesministerium für Wirtschaft hat dem
Deutschen Bundestag im Jahr 2003 über die Erfahrungen mit den Wettbewerbsbedingungen der
Regelungen zum verhandelten Netzzugang und zur Netzzugangsalternative zu berichten. Nach
Auswertung dieser Erfahrungen und der einschlägigen Rechtsprechung soll darüber
entschieden werden, ob zur Erreichung der Ziele des § 1 und zur Gewährleistung wirksamen
Wettbewerbs Änderungen der Regelung des Netzzugangs erforderlich sind, damit
gleichwertige Marktöffnung sowie ein direkt vergleichbarer Zugang zu den
Elektrizitätsmärkten erreicht werden. Sofern im Rahmen dieser Überprüfungen keine
andere Regelung getroffen wird, treten die Bewilligungen nach § 7 Abs. 1 spätestens am
31. Dezember 2005 außer Kraft.
§ 9 - Rechnungslegung der
Elektrizitätsversorgungsunternehmen
(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen der allgemeinen
Versorgung haben, auch wenn sie nicht in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft
betrieben werden, einen Jahresabschluß nach den für Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften des Ersten und Dritten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten
Buchs des Handelsgesetzbuchs aufzustellen und prüfen zu lassen. Soweit eine Verpflichtung
zur Offenlegung nach den §§ 325 bis 329 des Handelsgesetzbuchs nicht besteht, ist eine
Ausfertigung des Jahresabschlusses in der Hauptverwaltung zur Einsicht bereitzuhalten.
(2) Elektrizitätsversorgungsunternehmen der allgemeinen
Versorgung haben in ihrer Buchführung getrennte Konten für die Bereiche Erzeugung,
Übertragung und Verteilung sowie für Aktivitäten außerhalb des Elektrizitätsbereichs
zu führen. Sie haben für jede Aktivität und die zusammengefaßten Aktivitäten
außerhalb des Elektrizitätsbereichs eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung
in den Anhang ihres Jahresabschlusses aufzunehmen. Soweit dabei eine direkte Zuordnung zu
den einzelnen Aktivitäten nicht möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden
wäre, hat die Zuordnung durch Schlüsselung der Konten, die sachgerecht und für Dritte
nachvollziehbar sein muß, zu erfolgen.
(3) Im Anhang zum Jahresabschluß sind die Regeln
anzugeben, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die
ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge den Konten nach Absatz 2 zugewiesen werden.
Änderungen dieser Regeln in Ausnahmefällen sind zu erläutern und zu begründen.
(4) Im Anhang zum Jahresabschluß sind die
Geschäfte größeren Umfangs, die mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen oder mit
Unternehmen derselben Aktionäre getätigt worden sind, gesondert darzustellen.
§ 10 - Allgemeine Anschluß- und
Versorgungspflicht
(1) Energieversorgungsunternehmen haben für
Gemeindegebiete, in denen sie die allgemeine Versorgung von Letztverbrauchern
durchführen, Allgemeine Bedingungen und Allgemeine Tarife für die Versorgung in
Niederspannung oder Niederdruck öffentlich bekanntzugeben und zu diesen Bedingungen und
Tarifen jedermann an ihr Versorgungsnetz anzuschließen und zu versorgen. Diese Pflicht
besteht nicht, wenn der Anschluß oder die Versorgung für das
Energieversorgungsunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist.
Unterschiedliche Allgemeine Tarife für verschiedene Gemeindegebiete sind nicht zulässig,
es sei denn, daß hierfür ein sachlich gerechtfertigter Grund nachgewiesen wird, dadurch
für keinen Kunden eine Preiserhöhung entsteht und die Preisunterschiede für alle Kunden
zumutbar sind.
(2) Wer zur Deckung des Eigenbedarfs eine Anlage zur
Erzeugung von Energie betreibt oder sich von einem Dritten versorgen läßt, kann sich
nicht auf die allgemeine Anschluß- und Versorgungspflicht nach Absatz 1 Satz 1 berufen.
Er kann aber Anschluß und Versorgung im Umfang und zu Bedingungen verlangen, die für das
Energieversorgungsunternehmen wirtschaftlich zumutbar sind. Satz 1 gilt nicht für die
Deckung des Eigenbedarfs von Tarifabnehmern aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 30
Kilowatt elektrischer Leistung und aus erneuerbaren Energien.
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates regeln, in welchem Umfang und zu
welchen Bedingungen Anschluß und Versorgung nach Absatz 2 Satz 2 wirtschaftlich zumutbar
sind. Dabei sind die Interessen der Energieversorgungsunternehmen und der Abnehmer unter
Beachtung des Ziels einer möglichst sicheren, preisgünstigen und umweltverträglichen
Energieversorgung angemessen zu berücksichtigen.
§ 11 - Allgemeine Tarife und
Versorgungsbedingungen
(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Gestaltung der Allgemeinen Tarife der
Elektrizitätsversorgungsunternehmen unter Berücksichtigung des Gesetzeszweckes regeln
und diese Tarife von einer Genehmigung abhängig machen. Es kann dabei Bestimmungen über
Inhalt und Aufbau der Tarife treffen sowie die tariflichen Rechte und Pflichten der
Elektrizitätsversorgungsunternehmen und ihrer Abnehmer regeln. Es kann bestimmen, daß
bei der Genehmigung der Tarife Aufwendungen eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens
für Maßnahmen zur sparsamen und rationellen Verwendung von Elektrizität bei den
Abnehmern bei der Feststellung der Kosten- und Erlöslage des Unternehmens anerkannt
werden, sofern diese Maßnahmen elektrizitätswirtschaftlich rationeller Betriebsführung
entsprechen und den Wettbewerb nicht verzerren.
(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Allgemeinen Bedingungen für die
Belieferung von Tarifabnehmern mit Energie angemessen gestalten und dabei die Bestimmungen
der Verträge einheitlich festsetzen und Regelungen über den Vertragsabschluß, den
Gegenstand und die Beendigung der Verträge treffen sowie Rechte und Pflichten der
Vertragspartner festlegen. Hierbei sind die beiderseitigen Interessen angemessen zu
berücksichtigen. Dem Interesse des Anschlußnehmers an kostengünstigen Lösungen ist
dabei besonderes Gewicht beizumessen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für
Bedingungen öffentlich-rechtlich gestalteter Versorgungsverhältnisse mit Ausnahme der
Regelung des Verwaltungsverfahrens.
§ 12 - Enteignung
(1) Die Entziehung oder die Beschränkung von Grundeigentum
oder von Rechten am Grundeigentum im Wege der Enteignung ist zulässig, soweit sie für
Vorhaben zum Zwecke der Energieversorgung erforderlich ist.
(2) Die Zulässigkeit der Enteignung nach Absatz 1 stellt
die Behörde fest.
(3) Das Enteignungsverfahren wird durch
Landesrecht geregelt.
§ 13 - Wegenutzungsverträge
(1) Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege für
die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen zur
Netzsteuerung und Zubehör, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern
diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen. § 6 Abs. 3 gilt für
Elektrizitätsversorgungsleitungen bis zum Ablauf der Frist gemäß § 8 entsprechend.
Unbeschadet ihrer Verpflichtungen nach Satz 1 können die Gemeinden den Abschluß von
Verträgen ablehnen, solange das Elektrizitätsversorgungsunternehmen die Zahlung von
Konzessionsabgaben in Höhe der Höchstsätze nach § 14 Abs. 2 verweigert und eine
Einigung über die Höhe der Konzessionsabgaben noch nicht erzielt ist.
(2) Verträge von Energieversorgungsunternehmen mit
Gemeinden über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb
von Leitungen zur Durchführung der allgemeinen Versorgung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 im
Gemeindegebiet dürfen höchstens für eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen werden.
Werden solche Verträge nach ihrem Ablauf nicht verlängert, so ist das bisher versorgende
Unternehmen verpflichtet, seine für die allgemeine Versorgung im Gemeindegebiet
notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen Energieversorgungsunternehmen gegen Zahlung einer
wirtschaftlich angemessenen Vergütung zu überlassen.
(3) Die Gemeinden machen spätestens zwei Jahre vor Ablauf
von Verträgen nach Absatz 2 das Vertragsende in geeigneter Form bekannt. Sofern sich
mehrere Unternehmen bewerben, macht die Gemeinde bei Neuabschluß oder Verlängerung von
Verträgen nach Absatz 2 ihre Entscheidung unter Angabe der maßgeblichen Gründe
öffentlich bekannt.
(4) Die Absätze 2 und 3 finden für Eigenbetriebe der
Gemeinden entsprechend Anwendung.
(5) Die Aufgaben und Zuständigkeiten der
Kartellbehörden nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen bleiben unberührt.
§ 14 - Konzessionsabgaben
(1) Konzessionsabgaben sind Entgelte, die
Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung
von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie mittels Benutzung öffentlicher
Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen entrichten.
(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Zulässigkeit und Bemessung der
Konzessionsabgaben regeln. Es kann dabei jeweils die Elektrizität oder Gas, für
verschiedene Kundengruppen und Verwendungszwecke und gestaffelt nach der Einwohnerzahl der
Gemeinden unterschiedliche Höchstsätze in Pfennigen je gelieferter Kilowattstunde
festsetzen.
(3) Konzessionsabgaben sind in der vertraglich vereinbarten
Höhe auch für Energie zu zahlen, die mittels Durchleitung an Letztverbraucher im
Gemeindegebiet geliefert wird.
(4) Die Pflicht zur Zahlung der vertraglich
vereinbarten Konzessionsabgaben besteht auch nach Ablauf der Konzessionsvertrages für ein
Jahr fort, es sei denn, daß zwischenzeitlich eine anderweitige Regelung getroffen wird.
§ 15 - Konzessionsabgaben für die
Wasserversorgung
Für die Belieferung von Letztverbrauchern im
Rahmen der öffentlichen Wasserversorgung gilt § 14 entsprechend.
§ 16 - Anforderungen an
Energieanlagen
(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben,
daß die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger
Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe
1. von Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker,
2. von Gas die technischen Regeln des Deutschen Vereins des
Gas- und Wasserfachs e. V.
eingehalten worden sind.
(3) Bei Anlagen oder Bestandteilen von Anlagen, die nach
den in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden Regelungen
oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt und in den Verkehr gebracht wurden und die
gleiche Sicherheit gewährleisten, ist davon auszugehen, daß die Anforderungen nach
Absatz 1 an die Beschaffenheit der Anlagen erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen
ist auf Verlangen der Behörde nachzuweisen, daß die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt
sind.
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft
kann, soweit Fragen des Arbeitsschutzes betroffen sind, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Rechtsverordnungen mit Zustimmung des
Bundesrates über Anforderungen an die technische Sicherheit von Energieanlagen erlassen.
§ 17 - Vorratshaltung zur Sicherung
der Energieversorgung
Das Bundesministerium für Wirtschaft wird ermächtigt, zur
Sicherung der Energieversorgung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. Vorschriften zu erlassen über die Verpflichtung von
Energieversorgungsunternehmen sowie solcher Eigenerzeuger von Elektrizität, deren
Kraftwerke eine elektrische Nennleistung von mindestens 100 Megawatt aufweisen, für ihre
Anlagen zur Erzeugung von
a) Elektrizität ständig diejenigen Mengen an Mineralöl,
Kohle oder sonstigen fossilen Brennstoffen,
b) Gas aus Flüssiggas ständig diejenigen Mengen an
Flüssiggas
als Vorrat zu halten, die erforderlich sind, um 30 Tage
ihrer Abgabeverpflichtungen an Elektrizität oder Gas erfüllen oder ihren eigenen Bedarf
an Elektrizität decken zu können,
2. Vorschriften zu erlassen über die Freistellung von
einer solchen Vorratspflicht und die zeitlich begrenzte Freigabe von Vorratsmengen, soweit
dies erforderlich ist, um betriebliche Schwierigkeiten zu vermeiden oder die
Brennstoffversorgung aufrechtzuerhalten,
3. den für die Berechnung der Vorratsmengen maßgeblichen
Zeitraum zu verlängern, soweit dies erforderlich ist, um die Vorratspflicht an Rechtsakte
der Europäischen Gemeinschaften über Mindestvorräte fossiler Brennstoffe anzupassen.
§ 18 - Aufsichtsmaßnahmen,
Auskunftspflicht, Betretungsrecht
(1) Die Behörde überwacht die Einhaltung der Vorschriften
dieses Gesetzes. Sie kann im Einzelfall die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung
des Gesetzes anordnen.
(2) Die Energieversorgungsunternehmen haben auf Verlangen
der Behörde Auskünfte über technische und wirtschaftliche Verhältnisse zu geben, die
zur Überwachung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten erforderlich sind. Der
Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.
(3) Die von der Behörde mit der Aufsicht
beauftragten Personen sind berechtigt, Betriebsgrundstücke, Geschäftsräume und
Einrichtungen der Energieversorgungsunternehmen zu betreten, dort Prüfungen vorzunehmen
sowie die geschäftlichen und betrieblichen Unterlagen der Energieversorgungsunternehmen
einzusehen, soweit dies zur Überwachung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten
erforderlich ist. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.
§ 19 - Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. ohne Genehmigung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 die
Energieversorgung aufnimmt,
2. entgegen § 18 einer Anordnung nicht Folge leistet oder
eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder
3. einer nach § 17 dieses Gesetzes oder nach dem bisher
geltenden Energiewirtschaftsgesetz erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
zweihunderttausend Deutsche Mark geahndet werden.
(3) Soweit in Bußgeldvorschriften, die nach dem
Energiewirtschaftsgesetz in der bisher geltenden Fassung erlassen sind, auf § 15 Abs. 2
Nr. 4 verwiesen wird, gelten diese Verweisungen als Verweisungen auf Absatz 1 Nr. 3.
Artikel 2: Änderung des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen
Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 20.2. 1990 (BGBl. I. S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 26.1. 1998 (BGBl. I S. 156, 340), wird wie folgt geändert:
Nach § 103a wird folgender § 103b eingefügt:
§ 103b: Die §§ 103 und 103a sind auf die Versorgung mit
Elektrizität und Gas nicht mehr anzuwenden. Für die Versorgung mit Wasser gelten sie bis
zur Aufhebung durch Bundesgesetz fort.
Artikel 3: Änderung sonstiger Gesetze
- § 18 des Gerätesicherheitsgesetztes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.10. 1992 (BGBl. I S. 1793), zuletzt geändert durch § 14 Abs. 6 des
Gesetzes vom 19.7. 1996 (BGBl. I S. 1019), wird gestrichen.
- Das Stromeinspeisungsgesetz vom 7.12. 1990 (BGBl. I S.
2633), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19.4. 1994 (BGBl. I S. 1618), wird wie
folgt geändert:
Die §§ 1 bis 4 werden durch
folgende §§ 1 bis 4a ersetzt:
§ 1 - Anwendungsbereich
Dieses Gesetz regelt die Abnahme und die Vergütung von
Strom, der ausschließlich aus Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie, Deponiegas, Klärgas
oder aus Biomasse im Geltungsbereich dieses Gesetzes gewonnen wird, durch öffentliche
Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Nicht erfaßt wird Strom
- aus Wasserkraftwerken, Deponiegas- oder Klärgasanlagen oder
aus Anlagen, in denen der Strom aus Biomasse gewonnen wird, mit einer installierten
Generatorleistung über 5 Megawatt sowie
- aus Anlagen, die zu über 25 vom Hundert der Bundesrepublik
Deutschland, einem Bundesland, öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen oder
Unternehmen gehören, die mit ihnen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes verbunden sind,
es sei denn, daß aus diesen Anlagen nicht in ein Versorgungsgebiet dieser Unternehmen
eingespeist werden kann.
§ 2 - Abnahmepflicht
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die ein
Netz für die allgemeine Versorgung betrieben, sind verpflichtet, den in ihrem
Versorgungsgebiet erzeugten Strom aus erneuerbarer Energie abzunehmen und den
eingespeisten Strom nach § 3 zu vergüten. Für Strom aus Erzeugungsanlagen, die sich
nicht im Versorgungsgebiet eines Netzbetreibers befinden, trifft diese Verpflichtung das
Unternehmen, zu dessen für die Einspeisung geeignetem Netz die kürzeste Entfernung von
Standorten der Anlage besteht. Mehrkosten auf Grund der §§ 2 und 4 können bei der
Rechnungslegung der Verteilung oder Übertragung zugeordnet und bei der Ermittlung eines
Durchleitungsentgelts in Ansatz gebracht werden.
§ 3 - Höhe der Vergütung
(1) Die Vergütung beträgt für Strom aus Wasserkraft,
Deponiegas, Klärgas sowie aus Biomasse mindestens 80 vom Hundert des
Durchschnittserlöses je Kilowattstunden aus der Stromabgabe von
Elektrizitätsversorgungsunternehmen an alle Letztverbraucher. Bei einem Wasserkraftwerk,
einer Deponiegas- oder Klärgasanlage mit einer Leistung über 500 Kilowatt gilt dies nur
für den Teil des eingespeisten Stroms des jeweiligen Abrechnungsjahres, der dem
Verhältnis von 500 Kilowatt zur Leistung der Anlage in Kilowatt entspricht; dabei bemißt
sich die Leistung nach dem Jahresmittel der in den einzelnen Monaten gemessenen höchsten
elektrischen Wirkleistung. Der Preis für den sonstigen Strom beträgt mindestens 65 vom
Hundert des Durchschnittserlöses nach Satz 1.
(2) Für Strom aus Sonnenenergie und Windkraft beträgt die
Vergütung mindestens 90 vom Hundert des in Absatz 1 Satz 1 genannten
Durchschnittserlöses.
(3) Der nach den Absätzen 1 und 2
maßgebliche Durchschnittserlös ist der in der amtlichen Statistik des Bundes jeweils
für das vorletzte Kalenderjahr veröffentlichte Wert ohne Umsatzsteuer in Pfennigen pro
Kilowattstunde. Bei der Berechnung der Vergütung nach den Absätzen 1 und 2 ist auf zwei
Stellen hinter dem Komma zu runden.
§ 4 - Härteklausel
(1) Soweit die nach diesem Gesetz zu vergütenden
Kilowattstunden 5 vom Hundert der vom Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Kalenderjahr
insgesamt über sein Versorgungsnetz abgesetzten Kilowattstunden übersteigen, ist der
vorgelagerte Netzbetreiber verpflichtet, dem aufnehmenden
Elektrizitätsversorgungsunternehmen die Mehrkosten, die durch die diesen Anteil
übersteigenden Kilowattstunden entstehen, zu erstatten. Zu diesen Mehrkosten zählt bei
vorgelagerten Netzbetreibern auch die Belastung mit dem Erstattungsanspruch nach Satz 1.
Ist ein vorgelagerter Netzbetreiber nicht vorhanden, so entfällt für diejenigen
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, bei denen die in den Sätzen 1 und 2 bezeichneten
Voraussetzungen vorliegen, mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den Eintritt dieser
Voraussetzungen folgt, die Pflicht nach § 2 Satz 1 bei Anlagen, die zu diesem Zeitpunkt
in wesentlichen Teilen noch nicht errichtet waren; bei Windkraftanlagen ist insoweit die
Aufstellung von Mast und Rotor maßgeblich.
(2) Die Verpflichtungen nach den §§ 2 und 3 bestehen
nicht, soweit ihre Einhaltung auch bei Anwendung der Erstattungsregelung nach Absatz 1
eine unbillige Härte darstellt. In diesem Fall gehen die Verpflichtungen auf den
vorgelagerten Netzbetreiber über.
(3) Eine unbillige Härte liegt insbesondere vor, wenn das
Elektrizitätsversorgungsunternehmen seine Stromabgabepreise spürbar über die Preise
gleichartiger oder vorgelagerter Elektrizitätsversorgungsunternehmen hinaus anheben
müßte.
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft hat
dem Deutschen Bundestag spätestens im Jahr 1999, in jedem Fall aber so rechtzeitig über
die Auswirkungen der Härteklausel zu berichten, daß vor Eintreten der Folgen nach Absatz
1 Satz 3 eine andere Ausgleichsregelung getroffen wird.
§ 4a- Selbstverpflichtung zugunsten
erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung
(1) Die Bundesregierung wirkt darauf hin, daß die
Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Wege freiwilliger Selbstverpflichtung zusätzliche
Maßnahmen zur Steigerung des Anteils der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren
Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung treffen.
(2) Die Bundesregierung kann nach Anhörung der beteiligten
Kreise Ziele festlegen, die in angemessener Frist erreicht werden sollen. Sie wird jeweils
nach zwei Jahren dem Deutschen Bundestag Bericht erstatten.
Artikel 4: Übergangsvorschriften
§ 1 - Laufende Konzessionsverträge
Laufende Konzessionsverträge einschließlich
der vereinbarten Konzessionsabgaben, bleiben trotz Wegfalls der Ausschließlichkeit im
übrigen unberührt.
§ 2 - Schutzklausel
Bis zum 31.12. 2006 können
Elektrizitätsversorgungsunternehmen den Netzzugang für Elektrizität, die aus dem
Ausland geliefert werden soll, ablehnen, soweit der zu beliefernde Abnehmer dort nicht
ebenfalls durch Dritte beliefert werden könnte.
§ 3 - Neue Länder
(1) Bei der Beurteilung, ob die Ablehnung des Netzzugangs
zur Belieferung von Abnehmern in den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Elektrizität gemäß Artikel 1 §§ 6 und 7
unzulässig oder im Sinne des § 22 Abs. 4 und § 26 Abs. 2 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen mißbräuchlich, diskriminierend oder unbillig behindernd ist,
ist die Notwendigkeit einer ausreichend hohen Verstromung von Braunkohle aus diesen
Ländern besonders zu berücksichtigen.
(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft hat dem Deutschen
Bundestag im Jahre 2002 über die Auswirkungen dieser Regelung auf die
Braunkohleverstromung und Strompreisentwicklung in den Ländern nach Absatz 1 zu
berichten. Sofern auf der Grundlage dieses Berichts keine Verlängerung bis zum 31.12.
2005 vorgenommen wird, tritt diese Übergangsvorschrift am 21.12. 2003 außer Kraft.
(3) Absatz 1 gilt für die Verlegung von
Elektrizitätsversorgungsleitungen gemäß Artikel 1 § 13 Abs. 1 entsprechend.
Artikel 5 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach Verkündung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
- das Energiewirtschaftsgesetz in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 752-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19.12. 1977 (BGBl. I S. 2750),
- die Zweite Verordnung zur Durchführung des
Energiewirtschaftsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.1. 1987 (BGBl. I S.
146)
- die Dritte Verordnung zur Durchführung des
Energiewirtschaftsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.12. 1985 (BGBl. I S.
2253), geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 12.12. 1996 (BGBl. I S. 1914), und
- die Bundestarifordnung Gas in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 721-4. veröffentlicheten bereinigten Fassung, geändert durch §
35 der Verordnung vom 21.6. 1979 (BGBl. I S. 676).
Seitenanfang |
![]() Tagebau
Hambach I Autobahn 4 Bundesstraße
477 950MW
Block Niederaußem Hambacher Forst
Hambach Kohlebahn Hambacher Leck
Grünes Bauernopfer Hambach Leserbriefe
Downloads Aktuelle_Presse
Aktuelle Termine Historie
Bilddokumentation Stichwörter
Unsere Ziele Umweltlinks
Tagebau
Hambach I Autobahn 4 Bundesstraße
477 950MW
Block Niederaußem Hambacher Forst
Hambach Kohlebahn Hambacher Leck
Grünes Bauernopfer Hambach Leserbriefe
Downloads Aktuelle_Presse
Aktuelle Termine Historie
Bilddokumentation Stichwörter
Unsere Ziele Umweltlinks